Neurodiversität: existiert
Seit einigen Jahren steigen die Autismus- und ADHS-Diagnosen bei Frauen. Die Neurodiversitäts-Bewegung kämpft bereits seit Jahrzehnten dafür, neurodivergente Menschen nicht zu pathologisieren. Von Bettina Enzenhofer
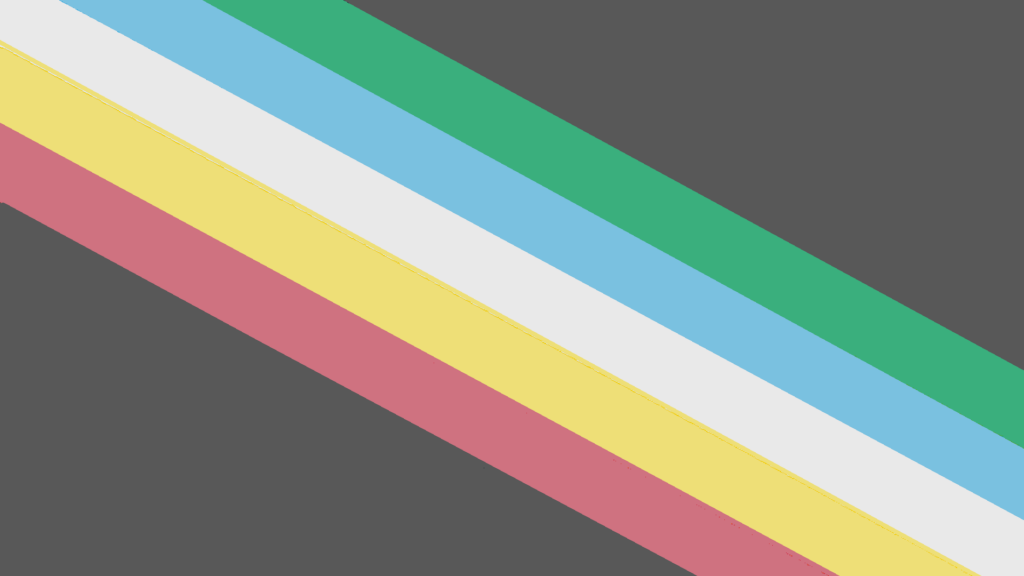
„Menschen unterscheiden sich darin, wie sie Reize verarbeiten. Es gibt neurologisch betrachtet eine Vielfalt“, sagt Michaela Hartl. „Der Neurodiversitäts-Begriff repräsentiert das. Es ist relativ neu, dass er im deutschen Sprachraum stärker verwendet wird.“ Hartl berät bei „8ung“ neurodivergente Menschen. „Neurodiversität ist eine Bereicherung für die Gesellschaft. Manche dieser neurologischen Varianten bringen aber für die Menschen, die davon betroffen sind, große Schwierigkeiten mit sich.“
Neurologische Vielfalt anerkennen
Laut aktuellen Studien sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung neurodivergent. Der Begriff kommt aus der Community: Die mehrfach neurodivergente Neurodiversitäts-Aktivistin Kassiane Asasumasu hat ihn im Jahr 2000 geprägt. Er soll alle Menschen inkludieren, die neurologisch nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, also nicht neurotypisch sind. Darunter fallen beispielsweise Autist*innen, Menschen mit ADHS, Dyslexie, Tourette, Epilepsie, Parkinson oder psychischen Erkrankungen. Die Bandbreite neurodivergenter Menschen ist groß, es können unterschiedliche Charakteristiken, Erfahrungen und Bedarfe im Vordergrund stehen. Manche neurodivergente Menschen benötigen viel Unterstützung im Alltag, andere können sich stärker anpassen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie auf Barrieren stoßen in einer neurotypischen Welt, die mit ihren Anforderungen, Erwartungshaltungen und Sinneseindrücken für neurodivergente Menschen oft sehr herausfordernd ist.
Seit den 1990er-Jahren kämpft die von Autist*innen initiierte Neurodiversitäts-Bewegung für die Rechte von behinderten Menschen, für Entstigmatisierung, Antidiskriminierung und Gleichberechtigung, für das Anerkennen neurologischer Vielfalt. Den Begriff „Neurodiversity“ hat vor 25 Jahren die Autistin und Soziologin Judy Singer eingeführt. Mittlerweile sind neurodivergente Personen sichtbarer geworden: in den Medien ebenso wie in der Forschung. Promis wie Paris Hilton oder Hannah Gadsby haben sich als neurodivergent geoutet. Auf Instagram und TikTok klären Aktivist*innen darüber auf, was es bedeutet, mit ADHS zu leben oder autistisch zu sein. Manche Elternteile erfahren durch die Autismus- oder ADHS-Diagnose ihres Kindes, dass sie selbst ebenso in diese Spektren fallen: Autismus und ADHS haben eine starke genetische Komponente.
Sexistischer Bias
Seit einigen Jahren steigen die Autismus- und ADHS-Diagnosen insbesondere bei Frauen. Ging man in der geschlechtlich binären Forschung bislang von einer Geschlechtsverteilung von 4:1 aus, so ist mittlerweile klar: Autismus und ADHS waren bei Mädchen/Frauen unterdiagnostiziert, und das lange vorherrschende weiße, männliche Bild von ADHS und Autismus – „der Zappelphilipp“, „der empathielose Autist“ – hat die Realität noch nie adäquat beschrieben. „Gerade bei Frauen ist es wichtig, genau hinzuschauen“, sagt Hartl. „Es gibt immer noch viele Fachleute, die auf neurodivergente Menschen spezialisiert sind, aber bei bestimmten Charakteristiken ADHS oder Autismus ausschließen.“ Jahrzehntelang hatte die Autismus- und ADHS-Forschung vorwiegend Männer im Blick, wodurch auch die Diagnosekriterien einen Bias haben. Autist*innen und Menschen mit ADHS, deren Charakteristiken sich anders zeigen bzw. die sich stark an eine neurotypische Welt anpassen, werden dadurch oft erst spät diagnostiziert.
ADHS
Lia S. hat lange ausgeschlossen, ADHS zu haben. Als sie ihre Psychiaterin eines Tages fragte, ob sie sich auf ADHS testen lassen würde, war S. bereits Ende dreißig. Erst dann habe sie nachgelesen, wie unterschiedlich sich ADHS bei Frauen zeigen kann, erzählt Lia S. ADHS steht für eine „Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung“. Als klassische Charakteristiken gelten Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität, doch diese können sich bei jeder Person unterschiedlich zeigen und im Laufe des Lebens verändern. Menschen mit ADHS können in Bereichen wie Zeitmanagement, Aufmerksamkeitsdauer oder Handlungsdurchführung eingeschränkt sein, wissen das jedoch vor der Diagnose nicht und suchen oft die Schuld bei sich – hören sie doch auch von ihrem Umfeld, sie müssten sich nur mehr anstrengen, dann ginge das schon. Laut Studien zeigt sich ADHS bei Mädchen bzw. Frauen oft ohne die klassisch nach außen gerichtete Hyperaktivität, wodurch sie weniger auffallen. So auch bei Lia S. „Ich bin sehr intelligent, sprachlich begabt, verstehe schwierige Theorien“, erzählt S. „Gleichzeitig bin ich in meinem Leben immer hinter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben. In der Schule war ich in manchen Fächern die Beste, in anderen bin ich durchgefallen.“ Lia S. heißt in Wirklichkeit anders. Da ADHS so negativ besetzt sei, habe sie nur ihren engsten Freund*innen von ihrer ADHS-Diagnose erzählt. Entgegen der Vorurteile seien aber viele Menschen mit ADHS sehr sensibel und feinfühlig, kreativ und begeisterungsfähig. Wer so viel Input bekomme, könne auch viel Output geben und für andere da sein, habe im Berufsleben gute Ideen und wertvolle Kontakte.
„ADHS ist wie ein Karussell, 500.000 Gedanken auf einmal“, sagt Lia S. „Ganz ADHS-klassisch ist bei mir zum Beispiel, dass ich nie etwas fertigbringen kann. Ich fange viele Dinge an, weil mir die Konzentration auf nur eine Sache fehlt, die kann mein Hirn nicht herstellen. Außer, wenn ich im Hyperfokus bin: Dann konzentriere ich mich nur noch darauf, arbeite stundenlang an einem Text.“ Aber: „Ich priorisiere dann falsch, weil ich den einen Anruf, der nur drei Minuten gedauert hätte und der heute dringend gewesen wäre, nicht mache.“ Auch Ordnung falle ihr schwer – in der Wohnung, in der Organisation von Aufgaben, generell im Leben. Sie verliere schnell die Geduld, werde leicht wütend, vor allem auf sich selbst, erzählt S. Anders als bei vielen Menschen mit ADHS sei das Halten von Freundschaften für sie aber kein Problem – im Gegenteil, sie brauche viel Input von verschiedenen Menschen und habe auffallend viele Freundschaften. „Ich habe viel Energie und schaffe sehr viel. Aber irgendwann kommt immer der Punkt, wo ich zusammenfalle – typisch für ADHS. Dass man sich letztlich wieder verkalkuliert und über seine eigenen Grenzen geht.“
Verschränkungen
Menschen mit ADHS und Autist*innen bekommen oft eine Reihe anderer Diagnosen, bevor sie erfahren, dass sie (auch) neurodivergent sind: Depression, Angststörung, Borderline. Selbst wenn diese Diagnosen korrekt sein sollten – oft genug sind sie es nicht – erklären sie nur einen Teil der individuellen Schwierigkeiten. Lia S. lebt schon lange mit Depressionen, die auch durch Antidepressiva nicht besser wurden. „Bei mir sind Trauma, ADHS und Depression miteinander verschränkt. Es kann sein, dass meine Depression besser wird, weil ich nun weiß, dass ich ADHS habe. Dadurch kann ich einfacher zugeben, dass ich in manchen Bereichen konkrete Unterstützung benötige“, erzählt S. „Oft heißt es, ADHS sei eine Modediagnose. Aber es geht darum, dass man etwas verbessern will.“ Für S. ist es wichtig, mit dem Konzept von Neurodiversität alle Menschen, deren Gehirne ganz unterschiedlich funktionieren, zu inkludieren. Gleichzeitig sieht sie für ihr eigenes Leben den Begriff der „Störung“ ebenso als passend: „Ich fühle mich in meinem Leben durch ADHS gestört, mein Leben ist ein Wahnsinn, es ist mir oft zu viel.“ Genauso wie bei ihrer körperlichen Behinderung gelte auch für ADHS: „Ich will das nicht wegwischen und so tun, als wäre es ganz normal – es gibt Menschen, die leben mit nichts von alldem. Ich will die Besonderheit, damit zu leben, differenzieren können.“
Es gibt viele Überlappungen unter neurodivergenten Gruppen und mit weiteren Minderheiten: Beispielsweise haben Menschen mit ADHS häufig auch Tics, Dyslexie oder Dyspraxie (motorische Schwierigkeiten); Autist*innen haben öfter Dyspraxie als Nicht-Autist*innen; auch Dyslexie und Dyskalkulie (Schwierigkeiten beim Rechnen) treten oft gemeinsam auf. Autist*innen sind häufiger trans/nicht-binär/agender, lesbisch, schwul, bi- oder asexuell als Nicht-Autist*innen – auch dazu gibt es mittlerweile Studien, wenn auch noch keine Erklärung. Eine Hypothese ist, dass sich queere und neurodivergente Personen weniger an sozialen Normen orientieren. Nicht nur die heteronormative Welt kann gequeert werden, sondern auch die neurotypische, so Nick Walker. Die queere, autistische Psychologin verwendet dafür den Begriff „neuroqueer(en)“ – ein Konzept, das Praxis und Identität gleichermaßen sein kann.
Autismus
Fünfzig bis siebzig Prozent der Autist*innen haben ADHS. Imoan Kinshasa hat beide Diagnosen spät und nach vielen Fehldiagnosen bekommen. „Ich bin ultragut in medizinischen Sachen, das ist mein Spezialinteresse. Aber als Frau wird das nicht als Spezialinteresse erkannt“, erzählt die angehende Krankenschwester. Studien zeigen neben dem sexistischen Bias in der Autismus- und ADHS-Diagnostik auch einen rassistischen Bias: Schwarze Menschen, indigene Menschen und People of Color sind unterdiagnostiziert. „Schwarz zu sein, macht es nicht einfacher, als neurodivergent diagnostiziert zu werden. Wenn schon die blonde, blauäugige, konventionelle Durchschnittsfrau keine Diagnose bekommt – was soll ich dann machen, ich habe erst recht keine bekommen“, berichtet Kinshasa. Im Rückblick sei Autismus bereits in ihren Schulzeugnissen sichtbar, doch erst durch TikTok-Videos von Autist*innen habe sie verstanden: „Das bin doch ich, ich mache das auch so.“ Autismus ist ein Spektrum: Bereiche wie Kommunikation, Verhaltensweisen, Wahrnehmung und Interessen können bei jeder autistischen Person unterschiedlich ausgeprägt sein. So unterschiedlich, dass Autist*innen gern die Aussage zitieren: „Kennst du eine autistische Person, dann kennst du eine autistische Person.“
„Autismus macht mich in Bereichen wie der Kommunikation schwach, oder es stört mich gerade ein bestimmter Stoff auf der Haut und lenkt mich ab. Aber in vielen Bereichen macht mich Autismus stärker: Ich sehe Details und erkenne Muster, die andere nicht sehen. Ich höre sehr gut zu. Ich kann Aufgaben superschnell und perfekt erledigen. Aber ich muss mich vielleicht zwei Wochen auf ein Telefonat vorbereiten. Das macht niemanden besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und ich finde, das ist zu akzeptieren“, sagt Imoan Kinshasa. Doch autistische Menschen würden oft unterschätzt. Sie selbst habe früher Ableismus internalisiert und dachte, sie könne als Autistin mit ADHS nicht als Krankenschwester arbeiten. „Aber gerade in der Medizin ist es hilfreich, dass ich in einem bestimmten Ablauf keinen Punkt auslasse. Die Protokolle habe ich alle im Kopf.“ Schwierig sei aber oft, soziale Kontexte zu verstehen, was zu Missverständnissen führt.
Barrieren abbauen
„Wenn ich anderen sage, dass ich autistisch bin und ADHS habe, ist das kein Grund, mich zu bemitleiden. Es ist kein Krebs im Endstadium. Es ist nur ein Hinweis, dass man überlegt, wie man mit mir umgeht. Dass man zum Beispiel bei Aktivitäten überlegt, warum ich nicht bei der Gruppe sitze und sagt: Das ist okay, sie braucht ihre Pause, sie ist Autistin“, so Imoan Kinshasa. Seit der Diagnose sei sie ein freierer Mensch, müsse weniger maskieren, sich also weniger an neurotypische Menschen anpassen. Auch Michaela Hartl erlebt in ihrer Praxis, dass die meisten nach ihrer Diagnose erleichtert sind. Viele ihrer Klient*innen hätten durch die Anstrengung, im System zu funktionieren, und durch das oft jahrzehntelange Maskieren ein autistisches oder ADHS-Burnout. Ihr Rat: „Es geht nicht darum, einen Menschen zum Beispiel mit allen anderen Autist*innen in eine Autismus-Schublade zu stecken. Sondern zu fragen, was anderen Autist*innen geholfen hat, sich besser entfalten zu können.“
Dieser Text erschien zuerst in an.schläge VI/2023.