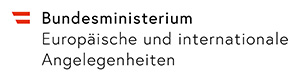Klimawandel: Massive Folgen für die Gesundheit
Brütend heiße Städte, überlange Pollensaison: Der menschengemachte Klimawandel bringt zahlreiche Gesundheitsrisiken mit sich. Vulnerable Gruppen wie chronische kranke oder armutsbetroffene Menschen sind besonders gefährdet – umso mehr braucht es klimagerechte Politik. Von Brigitte Theißl

Das ist die Zusammenfassung von einem Text über den Klimawandel und Gesundheit. Die Journalistin Brigitte Theißl hat den Text geschrieben.
Weltweit wird es immer heißer. Daran sind vor allem Menschen Schuld, weil sie Schadstoffe produzieren: zum Beispiel, wenn sie Autofahren oder in Fabriken Kohle verbrennen.
Die Hitze hat schlimme Folgen für die Gesundheit. Wenn es sehr heiß ist, können Menschen sogar einen Hitz-Schlag haben und sterben. Wegen dem Klimawandel gibt es mehr Allergien und Erkrankungen der Atemwege. Auch die psychische Gesundheit leidet unter dem Klimawandel. Und Menschen können sich an heißen Tagen schlechter konzentrieren. Es passieren dann mehr Arbeitsunfälle.
Alte und kranke Menschen leiden besonders unter der Hitze. Aber auch arme Menschen können sich schlechter vor der Hitze schützen. Sie wohnen oft in heißeren Wohnungen oder arbeiten in Berufen, wo sie der Hitze ausgesetzt sind.
Frauen leiden stärker als Männer unter dem Klimawandel, weil sie gesellschaftlich stärker benachteiligt sind. Sie müssen sich zum Beispiel öfter um andere Menschen kümmern. Das ist bei Hitze besonders anstrengend.
Der Klimawandel verstärkt solche Ungerechtigkeiten. Eine gerechte Klima- und Umwelt-Politik muss deshalb an alle Menschen denken. Nur dann schützt sie die Gesundheit aller Menschen.
Brigitte Theißl hat diese Zusammenfassung geschrieben. Hast du Fragen zum Text? Schreib an die Redaktion: be(at)ourbodies.at
Sommer 2024. Zum dritten Mal in dieser Juliwoche steigt das Thermometer über 33 Grad, die Wiener Innenstadt gleicht einem Backofen. Die Hitze ist eine drückende, die hohe Luftfeuchtigkeit sorgt für eine noch höhere gefühlte Temperatur. Auf den Straßen sind weniger Menschen unterwegs als sonst, vor den Wasserspendern stehen Tourist*innen Schlange. Längst hat sich in sozialen Netzwerken der Hashtag #Hitzesudern verbreitet, „Ich würd so gern einschlafen, aber der Schweiß rinnt noch in Bächen“, postet etwa Userin Karlakueken auf der Plattform X.
Die zunehmende Sommerhitze, eine Folge des menschengemachten Klimawandels, macht auch in Österreich der Bevölkerung zu schaffen. Wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) meldete, gab es in Österreich im vergangenen Jahr 53 Hitzetote.
Die Zunahme sogenannter Hundstage ist gut dokumentiert. Zwischen 1961 und 1990 gab es in Wien im Durchschnitt 9,6 Hitzetage mit über dreißig Grad pro Jahr, im Zeitraum 1990 bis 2010 ist dieser auf 17 Hitzetage jährlich angestiegen, meldet die Stadt Wien. Zwischen 2010 und 2018 waren es im Durchschnitt sogar 27 Tage mit über dreißig Grad. Und auch die Nächte bieten immer weniger Abkühlung. Die Zahl der Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter zwanzig Grad Celsius sinkt, ist deutlich gestiegen. Insgesamt ist die österreichweite Durchschnittstemperatur innerhalb der vergangenen 25 Jahre um 1 Grad Celsius gestiegen, im Sommer fällt der Anstieg mit 1,3 Grad am stärksten aus. Das zeigen die 2015 veröffentlichten österreichischen Klimaszenarien (ÖKS15).
Rücksichtslos klimaschädlich
Was nach einem geringen Unterschied klingt, hat massive Auswirkungen auf die Natur – und auf die Gesundheit der Bevölkerung. „Climate change presents a fundamental threat to human health“ („Der Klimawandel stellt eine grundlegende Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar“), so formuliert es die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 3,6 Milliarden Menschen würden bereits jetzt in Gebieten leben, die besonders anfällig für die schädlichen Folgen des Klimawandels sind. Dabei zeigt sich eine drastische globale Ungerechtigkeit: Obwohl sie nur sehr wenig zu den weltweiten Emissionen beitragen, haben Länder mit geringem Wohlstand und kleine Inselstaaten die schlimmsten gesundheitlichen Folgen zu tragen, so die WHO.
Wie der Climate Inequality Report 2023 zeigt, ist zudem die Ungleichheit innerhalb einzelner Länder besonders relevant. Die zehn Prozent der Weltbevölkerung mit dem höchsten CO₂-Ausstoß sind für die Hälfte aller Emissionen verantwortlich, das oberste Prozent verursacht sogar mehr Emissionen als die ärmere Hälfte der globalen Bevölkerung. Wohlhabende Menschen schaden dem Klima insgesamt deutlich mehr – die Bekämpfung des Klimawandels ist somit eine zentrale Klassenfrage.
Ein besonders plakatives Beispiel: Wie eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie zeigt, ist im Zuge der Corona-Pandemie in Europa die Anzahl der Privatjet-Flüge deutlich gestiegen, von 118.750 im Jahr 2020 auf 572.800 im Jahr 2022. Fast 3,4 Millionen Tonnen an CO₂ wurden auf diesem Weg im vergangenen Jahr ausgestoßen. Greenpeace fordert deshalb ein Verbot von Privatflügen in der EU. „Klimaschädliche Privatjets sind die rücksichtsloseste Form der Mobilität“, formuliert es eine Sprecherin der Organisation.
Arbeiten bei brütender Hitze – und ohne Toilette
Climate Equality oder Climate Justice ist ein Begriff, den Klimaaktivist*innen deshalb immer stärker in die klimapolitische Debatte einbringen. Er nimmt in den Fokus, dass die Folgen des menschengemachten Klimawandels Bevölkerungsteile sehr ungleich treffen. In der Arbeitswelt zeigt sich das besonders drastisch. Menschen, die im Freien arbeiten, sind der Hitze und schädlicher UV-Strahlung oft schutzlos ausgeliefert – etwa am Bau oder in der Landwirtschaft. Arbeitnehmer*innen sind deshalb häufiger von hellem Hautkrebs betroffen, die enorme Hitzebelastung kann zu einem Kreislaufkollaps oder zu Hitzschlägen führen – bis hin zum Hitztod. Bei starker Hitze steigt auch das Risiko für Arbeitsunfälle, wie der österreichische Gewerkschaftsbund betont. Klimaaktivist*innen von „Fridays for Future“ und „System Change not Climate Change“ haben sich daher mit der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft Bau-Holz zum Bündnis „Menschen und Klima schützen statt Profite“ zusammengeschlossen. Das Arbeitsrecht und Investitionen der öffentlichen Hand müssten sich an die Klimakrise anpassen, so ihre Forderung.
Die Hitzebelastung ist aber auch in Arbeitsbereichen, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, ein großes Thema, wie Carina Altreiter und Dorottya Kickinger im „Arbeit&Wirtschaft“-Blog schreiben. Wie die Autor*innen im Gespräch mit Betriebsrät*innen erfahren haben, kann etwa die Arbeitskleidung zur Belastung werden: zum Beispiel für Beschäftige im Gesundheitsbereich, die Schutzkleidung tragen müssen und darunter stark schwitzen. Aber auch fehlende Sanitäranlagen sind ein Problem. Bei großer Hitze soll viel getrunken werden, Beschäftige in der mobilen Pflege oder im öffentlichen Verkehr haben aber nicht ständig Zugang zu Toiletten – auch Monatshygieneprodukte zu wechseln wird so zum Spießroutenlauf. Und auch in Gesundheits- und Bildungseinrichtungen ist die Hitze besonders belastend – Branchen, in denen die Beschäftigten mit vulnerablen Gruppen wie alten Menschen, Kindern und erkrankten Personen arbeiten. Die Hitze wiederum lässt auch den Stress und die Aggression unter den Klient*innen steigen.
Die Ungleichheit schreibt sich schließlich im privaten Umfeld fort: Während manche Menschen in eine klimatisierte Wohnung oder ein unterkellertes Haus mit Garten heimkehren, kämpfen andere in den eigenen vier Wänden mit hohen Raumtemperaturen und den Auswirkungen des Individualverkehrs. Da unbezahlte Care-Arbeit unter den Geschlechtern höchst ungerecht verteilt ist, sind es wiederum Frauen, die besonders stark davon betroffen sind – denn wer nicht einfach heimkommen und sich ausruhen kann, sondern für die Care-Arbeit von Kindern oder Eltern zuständig ist, ist gesundheitlich noch stärker belastet, insbesondere zu Hitzezeiten. „Wie jede Krise verschärft auch die Klimakrise bestehende Ungerechtigkeiten zusätzlich“, bringen es die UN Women auf den Punkt. Frauen könnten etwa auch die Folgen von Naturkatastrophen schlechter verkraften, da sie durchschnittlich über geringere Ressourcen verfügen. Zum Beispiel ist für sie eine Flucht aufgrund von Naturkatastrophen schwieriger: Sie sind ökonomisch häufig benachteiligt, müssen sich auch um Angehörige kümmern und sind auf der Flucht stärker dem Risiko sexualisierter Übergriffe ausgesetzt.
Allergien und psychische Belastung
Zu den besonders vulnerablen Gruppen für die Folgen des Klimawandels zählen aber auch Vorerkrankte oder Immunsupprimierte, wie das deutsche Robert Koch Institut betont. Ein enger Zusammenhang existiert etwa zwischen Allergien und dem Klimawandel. Die Klimaerwärmung führt in Kombination mit der gestiegenen CO₂-Konzentration in der Luft zu früher startenden sowie längeren Blühzeiten bei Pflanzen, informiert die Initiative „Klima Mensch Gesundheit“. Aufgrund der gestiegenen CO₂-Konzentration in der Luft würden Pflanzen mehr und größere Pollen produzieren, insbesondere in städtischen Gebieten. Unter den neuen Pflanzen- und Tierarten, die aufgrund des veränderten Klimas heimisch werden, befinden sich auch solche, die besonders häufig Allergien auslösen. Eine erhöhte Ozonkonzentration wiederum begünstigt das Entstehen von Atemwegserkrankungen.
Nicht zuletzt hat die Klimakrise auch Folgen für die psychische Gesundheit. „Die Auswirkungen von klimabedingten Wetterereignissen und Naturkatastrophen auf die psychische Gesundheit sind bereits seit einiger Zeit bekannt. Sie verursachen Probleme wie Schlafstörungen, Stress, Angst, Depressionen und die Entwicklung von posttraumatischen Belastungsstörungen und Suizidgedanken“, ist im Journal of Health Monitoring 2013 zu lesen.
Klimapolitik intersektional gedacht
Dass Intersektionalität in der Klimapolitik indes nach wie vor zu kurz kommt, kritisiert etwa der „Disability Rights in National Climate Policies: Status Report“. Nur eine Minderheit der Vertragsstaaten des Pariser Abkommens beziehe Menschen mit Behinderungen in ihre Klimaanpassungsstrategien ein, so die Autor*innen. Konkrete Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte würden meist fehlen.
Klima- und Umweltschutz adressiert auch eines der zehn Gesundheitsziele in Österreich, die in einem partizipativen Prozess erarbeitet und 2012 schließlich von der Bundesgesundheitskommission und dem Ministerrat beschlossen wurden. „Die Menschen in Österreich sind Umweltbelastungen in unterschiedlichem Ausmaß ausgesetzt. Besonders gefährdete Gruppen und Kinder müssen speziell geschützt werden. Um die Gesundheit der Menschen dauerhaft zu bewahren, gilt es, Luft, Wasser, Boden und den gesamten natürlichen Lebensraum zu schützen und sauber zu halten“, heißt es in Ziel 4.
Eine möglichst gerechte Klima- und Umweltpolitik muss dabei stets Ungleichheitsdimensionen in all ihrer Überschneidung im Blick haben. Dafür plädieren auch die Autor*innen des Buchs „Klimasoziale Politik“, herausgegeben von Armutskonferenz, Attac und Beigewum. „Klimasoziale Politik strebt nach einer sozialen, inklusiven und politisch fortschrittlichen Gesellschaft, in der alle ein selbstbestimmtes Leben führen können, ohne dabei ihre eigene oder die Lebensgrundlage anderer zu gefährden“, ist in der Einleitung zu lesen.
Karen Bell, Wissenschafterin an der University of West England in Großbritannien, betont in ihrem Buch „Work-class Environmetalism. An Agenda for a Just and Fair Transition to Sustainability“ wiederum, dass viele Bewegungen, die seit Jahrzehnten für Klima- und Umweltschutz kämpfen, kaum Aufmerksamkeit bekommen würden. Medien und Wissenschaft würden sich zum Beispiel besonders für den – oft aufsehenerregenden – Aktivismus der Mittelschicht in den Industrienationen interessieren. Bei globalen Klimakonferenzen hätten sich immer schon Nationen des globalen Südens besonders stark eingebracht, in indigenen Communities sei Umweltschutz ganz elementar in der Kultur verankert. Und auch Gewerkschaften und Arbeiter*innenkämpfe seien oft Vorreiter*innen gewesen, wenn sie zum Beispiel gegen den Einsatz von giftigen Chemikalien am Arbeitsplatz kämpfen und Umwelt- und Klimaschutz mit dem Schutz der Gesundheit zusammendenken.
Der menschengemachte Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten, wie internationale Organisationen betonen. Doch jede einzelne Anstrengung lohnt sich, um die Folgen einzudämmen – auch um die Gesundheit aller zu schützen.
Dieser Artikel wurde gefördert durch: