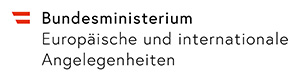Tödliche Datenlücken: Der Gender-Data-Gap in der Medizin
Seit Jahrzehnten kritisieren Feminist*innen und Gendermediziner*innen eine Medizin, in der der Mann als Norm gilt. 2023 mangelt es immer noch an geschlechtergerechter Forschung, Diagnostik und Behandlung. Von Schifteh Dohr-Hashemi

Jung, männlich und weiß. Viele Jahrhunderte waren der Mann, sein Gesundheitsverhalten und die ihm zugeschriebene Geschlechterrolle die Norm und dienten als vermeintlich neutrale Blaupause in der Medizin und Forschung. Ob in der Anatomie, in der Diagnostik, bei Medikamentenstudien oder Therapieempfehlungen: Viele bis heute gültige medizinische Leitlinien, Krankheitsbilder und Symptome sowie Arzneimittelstudien und Ausbildungsinhalte beruhen ausschließlich auf der Erforschung des männlichen Körpers.
Dieses systematische Fehlen von geschlechts- und genderspezifischen Daten, in überwältigender Weise zu Ungunsten von Frauen, aber insbesondere auch von LGBTIQ-Personen, bezeichnet man als Gender-Data-Gap. Mit Geschlecht ist hier das biologisch zugewiesene Geschlecht gemeint, mit Gender die soziale Geschlechterrolle.(1)
So führt auch der – nach zehn Jahren Pause – 2022 wieder erschienene Frauengesundheitsbericht für Österreich in seinen Schlussfolgerungen aus, dass sich „die Datenlage als besondere Herausforderung“ zeige, denn häufig seien die Daten „nicht aus Österreich, (…) nicht vorhanden, nicht repräsentativ oder schwer zugänglich“. Zudem gibt es in Österreich bislang, wenn überhaupt geschlechtergetrennt in der Medizin geforscht und analysiert wurde, nur binäre Datensätze.(2)
Um aber das Recht auf Gesundheit, das in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen für alle verbrieft ist, auch tatsächlich im und durch das Gesundheitssystem verwirklichen zu können, benötigen wir aussagekräftige und diskriminierungsfreie Daten. Dabei gilt nach dem Leitsatz der Weltgesundheitsorganisation, dass Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit bedeutet, sondern ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ist.
Frauen sind nicht kleinere Männer
Erst seit den 1980er-Jahren, angetrieben von ersten feministischen Stimmen und Forschungen, wurde die medizinische und ethische Relevanz für geschlechter- und genderspezifische Daten gesehen. Mittlerweile ist anerkannt, dass cis Frauen nicht einfach kleinere oder leichtere Männer sind, sondern sich zusätzlich zu reproduktiver und sexueller Gesundheit z.B. auch in Zellaufbau, beim Hormonhaushalt und damit im Immunsystem von cis Männern unterscheiden. Außerdem ist belegt, dass unterschiedliche Lebenswelten, Mehrfachbelastungen und Diskriminierungserfahrungen (was auch insbesondere LGBTIQ-Personen betrifft), gesundheitsrelevante Auswirkungen haben können – nicht nur auf die mentale Gesundheit. So zeigen Forschungen zu Diabetes an der Medizinischen Universität Wien rund um Alexandra Kautzky-Willer, Internistin und erste Professorin für Gendermedizin in Österreich, dass psychosozialer Stress, Schlafmangel oder Stress im Job bei cis Frauen häufiger zu Diabetes Typ 2 führen als bei cis Männern.
Immer häufiger werden geschlechter- und genderspezifische Unterschiede, aber auch Stereotype und Rollenklischees im Behandlungskontext (Gender Care Bias) thematisiert, seltener allerdings erforscht, um evidenzbasiert für alle Menschen die bestmögliche Prävention und Therapie ermöglichen zu können.
Geblieben sind allerdings eine historische Datenlücke, ein nur langsam zunehmendes Bewusstsein für das Ausmaß der Problematik und die Frage, wie zukünftig mit diesen lücken- und fehlerhaften Datensätzen umgegangen wird.
Tödliche Datenlücken
Das Phänomen des Gender-Data-Gaps ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zu beobachten. Fast immer wirkt sich diese Datenlücke negativ auf Frauen und LGBTIQ-Personen aus, diskriminiert und übersieht sie, erschwert oder gefährdet sogar ihr Leben. Ein bekanntes Beispiel sind die Crash-Test-Dummies in der Verkehrssicherheitsforschung, die sich bis vor wenigen Jahren rein an der Anatomie von cis Männern orientierten und somit sicherheitsrelevante Rückschlüsse für cis Frauen, die etwa eine schwächer ausgeprägte Hals- und Nackenmuskulatur haben können, kaum zuließen.
Auch in der Medizin gibt es mit zunehmender Forschung immer mehr Beispiele, die Goldstandards in Frage stellen und eine Unter- und Fehlversorgung bei Frauen und LGBTIQ-Personen aufzeigen. Dabei sind die Datenlücken noch größer, wenn man zusätzlich zu Geschlecht und Gender auch sozioökonomische Faktoren oder Lebenslagen wie Alter, Herkunft, Behinderung und chronische Krankheit berücksichtigen möchte. Dabei weiß die Gesundheitssoziologie schon lange, dass der sozioökonomische Status eines Menschen ein wesentlicher gesundheitsrelevanter Faktor ist.
Yentl-Syndrom und Endometriose
Symptome für ein und dasselbe Krankheitsbild können sich zwischen den Geschlechtern zum Teil gravierend voneinander unterscheiden – wobei auch hier die Forschung geschlechtlich binär ist. Der Begriff Yentl-Syndrom (nach einem Film mit Barbra Streisand) weist auf den unterschiedlichen Verlauf von Herzinfarkten bei cis Frauen im Vergleich zu cis Männern hin. Denn bei einem akuten Herzinfarkt weisen Frauen seltener den bekannten in den linken Arm ausstrahlenden heftigen Brustschmerz als vorrangiges Symptom auf. Bei ihnen fallen die Symptome diffuser aus. Denn obwohl ein Herzinfarkt immer durch eine Blockade in den Koronargefäßen entsteht, die das Herz versorgen, fällt die Ursache für diese Blockade unterschiedlich aus, wie aktuelle Forschungen zeigen. Bei cis Männern sind es häufig entzündliche Veränderungen der Gefäßwände, mit der Folge, dass ein Blutgerinnsel die Arterien blockiert. Bei cis Frauen ist es meist ein Koronarspasmus, das heißt die Gefäße krampfen und verengen sich, was wiederum zu einer Unterversorgung des Herzens führt. Anstatt oder zusätzlich zum Brustschmerz und der Kurzatmigkeit klagen cis Frauen häufig über Rücken- und Bauchschmerzen, über Übelkeit oder grippeähnliches Empfinden. Diese Variation in der Manifestation eines Herzinfarkts bei Frauen führt weiterhin häufig zu einer verspäteten Diagnosestellung in einem absolut zeitkritischen Notfallbild. Die Sterblichkeitsrate von cis Frauen nach einem Herzinfarkt liegt daher in Österreich mit 5,9 pro 100 Fällen über jenem von Männern (4,4 pro 100 Fälle).
Verspätete Diagnosen und Unterversorgung von Frauen sind aber nicht nur an einige wenige Krankheitsbilder gebunden. So schätzt etwa ein 2023 erschienener Bericht der Beratungsfirma McKinsey, dass für jede bei einer Frau gestellten Diagnose eine Dunkelziffer von fünf weiteren unentdeckten Betroffenen vorhanden ist. Bei Männern beträgt diese Dunkelziffer das Eineinhalbfache. Studien zeigen außerdem auf, dass Diagnosen für eine Vielzahl an schwerwiegenden Krankheiten (Herzkreislauferkrankungen, Krebs) bei Frauen je nach Krankheit im Schnitt zwei bis sechs Jahre später gestellt werden als bei Männern, obwohl Frauen häufiger zu Ärzt*innen gehen.
Der Gender-Data-Gap und damit eine Lücke in der Erforschung von Krankheitsbildern, Ursachen bzw. möglicher Therapieansätze zeigt sich auch bei Erkrankungen, die überwiegend cis Frauen betreffen, z.B. Autoimmunerkrankungen (Frauen stellen etwa 80% der Betroffenen), Endometriose, PCOS (Polyzystisches Ovarialsyndrom) oder Infertilität sowie beim Wissen rund um die Menopause. Bei der Endometriose geht man davon aus, dass ca. 10% der Menschen mit Uterus betroffen sind, aber nur vier von zehn Betroffenen eine Diagnose erhalten haben. Denn bis die Krankheit überhaupt diagnostiziert wird, dauert es im Schnitt sieben bis neun Jahre.
Black Box Pillen
Ein gewichtiger Grund für die klaffende Datenlücke ist der in den 1970er-Jahren – im Anschluss an den Contergan-Skandal – von Behörden empfohlene und insbesondere in frühen klinischen Phasen gelebte Ausschluss von cis Frauen im gebärfähigen Alter. Viele Jahrzehnte lang wurden somit an cis Männern gewonnene Ergebnisse aus Arzneimittelstudien zur allgemeinen Norm erklärt und auf Frauen übertragen. Wenn Frauen als Probandinnen überhaupt in Studien eingeschlossen waren, wurden die erhobenen Daten überwiegend nicht geschlechtergetrennt analysiert. Mit dem Ergebnis, dass Frauen über alle Medikamentengruppen hinweg ein zweifach höheres Risiko für Nebenwirkungen aufweisen, wobei Übelkeit die häufigste Nebenwirkung darstellt, gefolgt von der Wirkungslosigkeit des Medikaments. Außerdem landen Frauen signifikant häufiger aufgrund von Nebenwirkungen im Krankenhaus.
Zwar empfehlen sowohl die US-amerikanische FDA (Food and Drug Administration) als auch die europäische Arzneimittelbehörde (EMA), dass Studienproband*innen nach „Geschlecht und Alter“ repräsentativ für die Bevölkerungsgruppen sein sollen, die das Arzneimittel später auch anwenden, in die Praxis hat sich das aber noch nicht umgesetzt. Denn Frauen im gebärfähigen Alter sind laut Arzneimittelgesetz in Österreich wie in fast allen Staaten der Welt dazu verpflichtet, während der gesamten Studiendauer zuverlässig zu verhüten und Schwangerschaftstests zu machen, wenn sie an einer Studie teilnehmen wollen. Diese erschwerende Vorgabe und das damit implizit kommunizierte Zusatzrisiko für Frauen im gebärfähigen Alter führt dazu, dass sie sich seltener als Probandinnen melden. Aus Deutschland wissen wir: Frühe klinische Studien, bei denen ein neuer Wirkstoff erstmals am Menschen erprobt wird, werden weiterhin überwiegend mit männlichen Probanden durchgeführt. An 34% dieser Studien waren gar keine Frauen beteiligt. Das Problem dabei ist, dass genau in dieser Phase die Wirkung und der Abbau eines Medikaments im Körper untersucht und somit erste Grenzwerte und die Dosierung bestimmt werden. Das ist der Stoff, der Bioethikkommissionen beschäftigen sollte. Denn während der „Schutz der Frau und des Fötus“, wie es das Arzneimittelgesetz in Österreich formuliert, selbstverständlich zu beachten ist, ist ebenso abzuwägen, wie man Frauen vor wirkungslosen oder mit Nebenwirkungen gespickten Medikamenten schützt. Oder wie wir damit umgehen, dass es für die zunehmende Anzahl an chronisch kranken Schwangeren kaum getestete Medikamente gibt.
Historische Datenlast
Gesundheitswesen und Medizin werden in den kommenden Jahren – und das könnte eigentlich eine gute Nachricht sein – digitaler und datenbasierter. Daten spielen eine immer wichtigere Entscheidungsgrundlage in der Medizin, in der Gesundheitspolitik und bei Forschungsinvestitionen. Viele bahnbrechende Technologien werden in den nächsten Jahren durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) erwartet, etwa in der (bildgebenden) Diagnostik und Robotik. Die Nutzung von Daten ist sinnvoll. Kaum eine*r fragt jedoch, welche Datensätze die Grundlage für neue Anwendungsmöglichkeiten und Entscheidungssysteme stellen werden. Denn wie gehen wir damit um, dass die vorhandenen Datensätze gravierende Lücken und einen Geschlechter-Bias aufweisen? Welche Auswirkungen hat das auf die KI-Systeme, die mit diesen Daten trainiert werden? Was bedeutet das für die Erforschung neuer Therapieansätze und Medikamente, welchen Erkrankungen wird Priorität eingeräumt, wohin fließen die Forschungsgelder?
Gendermediziner*innen sind sich einig, dass es viel mehr Förderung für geschlechter- und gendergerechte Forschung durch neue Studien braucht. Aber auch vorhandene Studien, an denen Frauen teilgenommen haben, die aber nie geschlechtergetrennt analysiert wurden, können durch komplexe Big-Data-Analysen im Nachgang auf geschlechter- und gendergerechte Erkenntnisse geprüft werden. Außerdem müssen die vermehrt vorhandenen Forschungsergebnisse auch in die medizinischen Leitlinien diverser Krankheitsbilder Einzug finden, damit sie in die Lehrpläne fließen und (angehenden) Mediziner*innen auch tatsächlich gelehrt werden. Wie insgesamt verpflichtende Module zu Gendermedizin, frauenspezifischen Erkrankungen und ein Mainstreaming von geschlechter- und gendersensiblen Inhalten in den Ausbildungsplänen der Medizin-Universitäten gefordert werden. Die Aufnahme von frauen- und LGBTIQ-spezifischen Indikatoren in der Gesundheitsplanung würde dem Thema und der Notwendigkeit der Datenerfassung auf politischer Ebene Priorität einräumen. Zuletzt bedarf es eines umfassenden Umdenkens und der Anerkennung, dass wir in einer Welt leben, die auf von Männern für Männer erhobenen Daten beruht. Wir müssen uns der mangelhaften, diskriminierenden Datenbasis für KI-basierte Modelle bewusst sein, sie offenlegen und auch die Frage stellen, wer diese KI-Systeme entwickelt. Denn in beiden Bereichen sind Frauen und LGBTIQ-Personen bzw. die Erkenntnisse der Gendermedizin und somit auch geschlechter- und gendersensible Daten enorm unterrepräsentiert. Der Gender-Data-Gap in der Medizin ist nicht nur eine unbequeme Lücke, sondern hat reale Konsequenzen für Frauen und LGBTIQ-Personen. Manchmal sind die Konsequenzen tödlich.
Fußnoten:
(1) Die definitorische Unterteilung in geschlechter- und genderspezifische Aspekte (bzw. in biologisches und soziales Geschlecht) folgt insbesondere der Begrifflichkeit von „Gesundheit Österreich“ (siehe Frauengesundheitsbericht 2022). Sie soll allerdings keinesfalls als strikte Trennung gedeutet werden, da Sex und Gender in komplexen Wechselwirkungen zueinanderstehen und die biologische Geschlechtszuordnung durch viele Kriterien, uneindeutig und entlang eines Kontinuums erfolgen kann (chromosomales Geschlecht, hormonelles Geschlecht, gonadales Geschlecht, innere und äußere Geschlechtsorgane).
(2) Der Autorin ist wichtig zu betonen, dass auch die wenigen Datensätze, wo geschlechtergetrennt geforscht UND analysiert wurde, keine Informationen oder Rückschlüsse dafür liefern, welche Einschluss- oder Ausschlusskriterien für „Frau“ oder „Mann“ verwendet wurden. Wenn also im Text lediglich von (cis) Frauen gesprochen wird, liegt es insbesondere an den unpräzisen und rein binär vorliegenden Datensätzen.
Schifteh Dohr-Hashemi ist Sozioökonomin und Sozialexpertin. Sie war eine der Sprecher*innen des Frauen*Volksbegehrens 2019.
Dieser Artikel wurde gefördert durch: