Status, quo vadis?
Gender Medizin ist heute endgültig in Österreich angekommen. Eine kritische Bestandsaufnahme dieser jungen Disziplin von Bettina Enzenhofer.
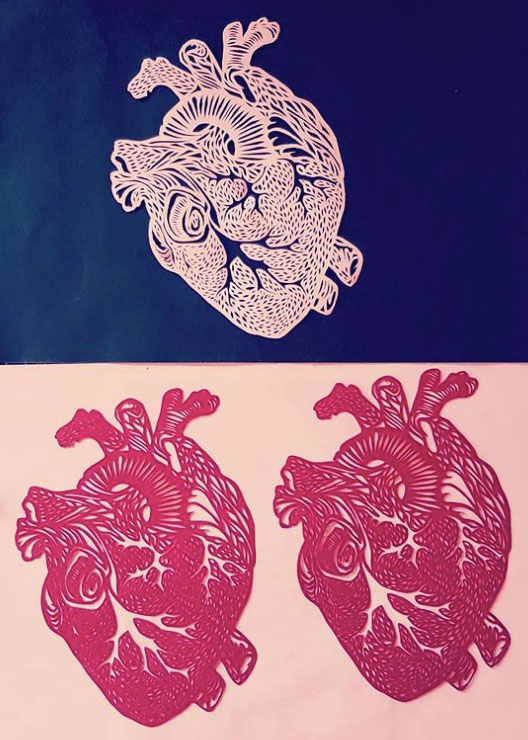
Sind Männer vom Mars, Frauen von der Venus? Ein derartiges Differenzdenken liegt gegenwärtig auch in der Medizin im Trend. Der aktuelle Name dafür: Gender Medizin. Das im englischsprachigen Raum als „Gender Based Medicine“ bekannt gewordene Fachgebiet richtet den Blick auf medizinisch relevante Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Es analysiert, ob, wie und warum es Diskrepanzen zwischen den Geschlechtern gibt: in der Entwicklung von Krankheiten, in der Behandlung sowie in der Verfügbarkeit von adäquaten Therapien und Diagnosemethoden. Auch sozialmedizinische Aspekte, wie die von Patient_innen selbst unternommenen Bemühungen zur Bewältigung ihrer Krankheit, die Bereitschaft zur Kooperation mit Ärzt_innen bzw. die Interaktion zwischen Ärzt_in und Patient_in, interessieren die geschlechtssensible Medizin. Den Begriff „Gender“ entlehnt die vergleichsweise junge Disziplin aus der Geschlechterforschung und sagt: Mit dem biologischen Geschlecht („Sex“) werden wir geboren, das soziale Geschlecht („Gender“) und damit geschlechtsspezifische Lebensbedingungen prägen sich aber auch in den Körper ein und haben einen mindestens ebenso großen Einfluss auf Krankheit und Gesundheit. Das Ziel einer geschlechtssensiblen Medizin ist eine für beide Geschlechter(1) angemessene medizinische Versorgung.
Organ-Inspektion
Gender Medizin ist mittlerweile auch in Österreich auf universitärer Ebene verankert: Im Jänner dieses Jahres wurde in Wien die erste und bisher einzige Professur für Gender Medicine an Alexandra Kautzky-Willer vergeben. Die Medizinische Universität Wien bietet außerdem seit diesem Wintersemester einen postgradualen Lehrgang zu Gender Medizin an. In die Curricula ist Gender Medizin ohnehin schon länger integriert – an den österreichischen medizinischen Universitäten kommen Studierende heute an den gesundheitsbezogenen Gender-Aspekten nicht mehr vorbei.
Die Österreichische Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin (ÖGGSM) tagt regelmäßig, in Berlin fand im September die „Summer School on Gender Medicine“ statt, und Ende November wird in Tel Aviv der 5. Kongress der International Society of Gender Medicine (IGM) ausgetragen. Mit der Etablierung der geschlechtssensiblen Medizin geht es also voran. Doch die Frage ist: Inwieweit ist Gender für die Gender Medizin wirklich relevant? Denn in den meisten Kongressprogrammen oder Büchern zum Thema ist die Abwesenheit der Gender Studies, die in Gender-Fragen die meiste Kompetenz hat, besonders auffällig. Davon unbeeindruckt werden unter dem Titel „Gender Medizin“ unterschiedlichste medizinische Fachrichtungen neu geschrieben: mit Fokus auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die nun „in nahezu jedem Organ des menschlichen Körpers“(2) entdeckt werden.
Hand aufs Herz
Angefangen hat alles mit der Kardiologin Marianne Legato. Sie erkannte Ende der 1980er Jahre, dass sich Frauen und Männer in puncto Herzkrankheiten unterscheiden. Legato gilt als Pionierin: Sie gründete 1997 das „Partnership for Gender-Specific Medicine“ an der Universität von Columbia und das „Journal of Gender-Specific Medicine“ (heute: „Gender Medicine“). Ihre Bücher waren wegweisend, ihr Wissen zu den kardiologischen Unterschieden zwischen Frauen und Männern ist heute einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Dachte man jahrzehntelang, dass z.B. ein Herzinfarkt typischerweise von Symptomen wie einem brennenden Druckschmerz, der in den linken Arm ausstrahlt, begleitet wird, so weiß man heute, dass bei jeder fünften Frau die Symptome ganz anders aussehen können: Schmerzen können im Oberbauch oder Rücken auftreten und zu Kurzatmigkeit, Übelkeit und Schweißausbruch führen.
Der Grund für dieses Unwissen war, dass Frauen in die medizinischen Studien schlichtweg nicht miteinbezogen wurden. Der Mann galt als Norm, in der androzentristischen Vorstellung funktionierte der weibliche Körper ident. Dies führte zu weiteren Irrtümern, wie etwa zu der Ansicht, dass Frauen bis ins hohe Alter nicht an koronaren Herzkrankheiten erkranken oder zumindest nur an milderen Formen als Männer. Nachdem bis dahin frauenspezifische Symptome nicht als Symptome einer Herzerkrankung wahrgenommen wurden, ein logischer Schluss. Äußerten Frauen ihre „atypischen“ Symptome, wurden sie nicht selten als hysterisch abgestempelt, eine Panikattacke oder dergleichen „diagnostiziert“. Heute weiß man, dass koronare Herzkrankheiten bei Frauen öfter zu einem Herzinfarkt führen und öfter tödlich verlaufen als bisher angenommen. Für eine richtige Behandlung ist eine korrekte Diagnose essenziell, Ärzt_innen sind also dazu aufgerufen, auch auf atypische Symptome zu achten. Und dies nicht nur bei Frauen – denn auch Männer können die „weiblichen“ Symptome aufweisen.
Neu dosiert
Mit der Erforschung kardiologischer Unterschiede machte die Gender Medizin Karriere und wurde mittlerweile um etliche andere Erkenntnisse erweitert: So kennt die Medizin heute z.B. in der Psychiatrie, der Onkologie, Rheumatologie oder Intensivmedizin geschlechtsspezifische Besonderheiten, ebenso werden u.a. das Immunsystem, das Knochengerüst, der Verdauungstrakt oder die Lunge unter die Gender-Lupe genommen. Von besonderer Relevanz ist die Pharmakologie: Arzneimittel wirken nämlich nicht bei allen Menschen gleich. Am individuellen Stoffwechsel sind viele Faktoren beteiligt, derselbe Wirkstoff kann deshalb bei mehreren Patient_innen ganz unterschiedlich umgesetzt werden und infolgedessen unterschiedliche (Neben-)Wirkungen zeigen. Selbst die Darreichungsform von Medikamenten kann ausschlaggebend für die Wirkung sein. Nachdem Frauen bis vor einigen Jahren aus klinischen Studien zur Arzneimittelwirkung ausgeschlossen waren und man von den Ergebnissen der Männerstudien auf Frauen schloss, überrascht die Erkenntnis der Pharmakologie nicht: Frauen vertragen Medikamente anders als Männer. Heute weiß man, dass Unterschiede der Arzneimittelverarbeitung aus individuellen Eigenschaften resultieren, aber auch Folgen genereller Umstände sein können – was uns wieder zum Geschlecht führt. Aber nicht nur die unterschiedliche Wirkung von Medikamenten muss in einer geschlechtssensiblen Medizin beachtet werden, auch die Verschreibungspraxis gehört hinterfragt. Denn Geschlechtsvorurteile und Unwissenheit seitens der Ärzt_innen können dazu führen, dass über- oder untermedikalisiert wird. Bis heute werden Frauen etwa mehr Psychopharmaka verschrieben als Männern.
Mehr Sex als Gender
Dass Unterschiede zwischen den Geschlechtern zunehmend bekannt und erforscht werden, scheint Frauen und Männern vorerst eine bessere medizinische Versorgung zu bringen. Die Unterschiede dürfen aber über eines nicht hinwegtäuschen: Es gibt auch Gemeinsamkeiten. In einzelnen Merkmalen können Frauen bzw. Männer innerhalb ihrer Geschlechtsgruppen mehr differieren als die Gruppen untereinander. Genau darum geht es auch in einer geschlechtssensiblen Medizin: Worin unterscheiden sich die Geschlechter – und worin gleichen sie sich? „Der Balanceakt einer frauen- und männergerechten Biomedizin besteht nun darin, diese Unterschiede einerseits durch klinische und experimentelle Studien herauszufinden und andererseits nicht durch Überbewertung der biologischen Unterschiede mögliche andere Einflüsse bei der Entstehung von Krankheiten zu übersehen“, schreibt die Humanbiologin Angelika Voß.(3) Gender Medizin bewegt sich also stets zwischen Sex und Gender. Doch genau in diesem Balanceakt entstehen Missverständnisse. Denn Gender Medizin ist heute, so wie sie meistens kommuniziert wird, eigentlich eine „Sex Medizin“, wie Expert_innen kritisieren. Der Fokus liege häufig auf biologischen Unterschieden, nicht jedoch auf sozialen oder strukturellen Bedingungen, wie es der Begriff Gender nahelegen würde. „Wo Gender draufsteht, ist sehr oft Gender nicht drinnen, sondern zwar auch wichtige und gut gemachte, aber streng naturwissenschaftlich biologisch-medizinische Forschung“, sagt die Wiener Frauengesundheitsbeauftragte Beate Wimmer-Puchinger(4). „Das was Gender Medicine aber meint, ist eine Analyse der Ergebnisse hinsichtlich der unterschiedlichen soziologischen Rollenmuster beziehungsweise der GenderGerechtigkeit.“ Oft wird es auch als „politisch korrekt“ angesehen, „Gender“ auf etwas zu schreiben, das eigentlich nur mit biologischen Faktoren zu tun hat, wie die Wissenschaftlerin Jennifer Fishman und ihre Kolleginnen feststellten(5) – ein begrifflicher Irrtum.
Begriffe unterm Mikroskop
Diese Begriffsverwirrung entsteht wohl auch deshalb, weil das Konzept „Gender“ für Mediziner_innen neu ist. „Es gibt viel Unverständnis. Die Sozial- und Naturwissenschaften schaffen es einfach nicht, aufeinander zuzugehen, das ist ein Kommunikationskonflikt“, sagt die Wissenschaftlerin Renate Baumgartner. „Mediziner_innen wollen sich oft auch nicht ihre selbstverständlichen Kategorien – wie die Differenz zwischen Frauen und Männern – infrage stellen lassen.“ Eine Universitätsangestellte, die nicht genannt werden will, erzählt: „Viele Lehrende haben den Eindruck: Sobald ich mich den Unterschieden zwischen Frauen und Männern widme, arbeite ich gendergerecht. Das hat aber mit Gendergerechtigkeit nichts zu tun, sondern ist biologistische Forschung.“
Auch in medizinischen Fachpublikationen werden die Begriffe häufig falsch verwendet, wie Nancy Krieger von der Harvard School of Public Health feststellte.(6) In den von ihr analysierten Texten würden Sex und Gender oft synonym gebraucht. Dies sei aber falsch – denn wir besitzen immer Gender und Sex gleichzeitig. Für bestimmte Gesundheitsbedingungen sei vielmehr zu fragen: Sind Sex und Gender beide relevant – oder keines oder nur eines von beiden? Und vor allem Forscher_innen müssen sich im Klaren darüber sein, mit welchem Begriff sie arbeiten, und damit auch, auf welcher Ebene – falls überhaupt – Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu finden sind.
Auch Angelika Voß und Brigitte Lohff kritisieren, „dass die Humanmedizin als normierende und standardisierende Disziplin und Disziplinierung des (geschlechtlich definierten) Körpers auf dem Fundament der ,sex based biology‘ ruht“. Dieses grundlegende Denken in biologisch manifesten Dichotomien werde aber durch eine geschlechtssensible Medizin nicht automatisch aufgelöst: „Denn mit der Feststellung des Andersseins als die Andere oder der Andere wird noch keine Garantie für die Anerkennung von Differenz als nicht-pathologisch, nicht-krankhaft und nicht-therapiebedürftig gegeben.“(7)
Geschlechterdualismus
Ein weiterer Kritikpunkt: Die Gender Medizin schöpfe ihr eigentliches Potenzial nicht aus. Denn der zunächst von der Queer Theory und danach auch von den Gender Studies hinterfragte Geschlechterdualismus, der in einer hierarchisierenden Geschlechterordnung gipfelt, wird von der Gender Medizin meist nicht angezweifelt. Stattdessen trifft der Begriff Gender „auf einen fest etablierten biologistischen Begriff von Geschlecht (sex), in dem nach wie vor eine fixe dichotome Geschlechterordnung als biologisch d.h. natürlich vorausgesetzt wird“, kritisiert auch die Medizinerin Alice Chwosta.(8) Gender verliere im medizinischen Diskurs an Weite und Vielfalt, bleibe stets eine pure Abgrenzung von Sex. „Die Gefahr eines rein in Abgrenzung verhafteten gender Begriffs ohne Verständnis für die Mechanismen der sozialen Konstruktion von Geschlecht unter dem Motto ,das, was nicht sex ist, nennen wir jetzt eben gender‘ ist (…) gegeben und bestätigt sich in der momentanen Entwicklung einer Gender Medizin, die vielfach soziales Frau- bzw. Mannsein als unhinterfragte Gegebenheit, wenn nicht biologisch, dann eben als sozial gelernt aufnimmt“, so Chwosta. Die für die Frauengesundheitsbewegung nach wie vor gültige Kritik an der Geschlechterordnung verschwinde in einer derartigen Gender Medizin.
Das bestätigt auch Victoria Grace von der School of Social and Political Sciences der Universität von Canterbury.(9) Gender Medizin dichotomisiere und essentialisiere das biologische Geschlecht, denn sie definiere „männlich“ und „weiblich“ als streng entgegengesetzt. Auch die Sex/Gender-Trennung, die eine „biologische“ Geschlechtskomponente von einer „sozialen“ unterscheidet, stehe der Re-Theoretisierung einer nicht-dualistischen Biologie entgegen. Denn gerade diese Fragestellungen der Gender Studies könnte eine kritische Gender Medizin aufnehmen: Wie können wir Geschlecht neu und nicht-dualistisch denken? Ohne Kritik am Geschlechterdualismus könnte sich Medizin in eine Richtung entwickeln, die Frauen und Männer als komplett unterschiedliche genetisch determinierte Gruppen betrachtet, die auch quantitativ und qualitativ anders behandelt werden müssten.
Für mehr Grauzonen
Gender Medizin könnte, will sie ihrem Namen gerecht werden, tatsächlich interdisziplinär ausgerichtet sein. Das würde zum einen bedeuten, dass sie Erkenntnisse von Gender Studies, Frauenforschung, Soziologie etc. ernst nimmt. Zum anderen würde sie auch andere Faktoren der Ungleichbehandlung und ihre Interaktion in Betracht ziehen: Geschlechtliche Arbeitsteilung, Armut, Stress etc. wirken sich auf die individuelle Gesundheit aus. Nicht unsere biologischen Anlagen, sondern vor allem die individuelle Lebenswelt sowie ihre spezifische historische, soziale und kulturelle Eingebundenheit sind relevant. „Hier schwindet gegenwärtig eine großartige Chance durch den Verlust einer geschlechterkritischen feministischen Perspektive“, schreibt Chwosta. „Jene Grauzonen der Intersektion von Biologie und sozialer Umwelt, die in der Festschreibung in den Körper betrachtet werden könnten, werden aus dem Blick verloren. Denn auch das ist Gender Medizin, oder könnte es sein.“ Und Voß sieht noch eine weitere Chance: Durch die Geschlechterperspektive werde nämlich auch die Hierarchie, in der die Biologie an der Spitze, die sozialen, kulturellen und psychischen Einflussfaktoren hingegen weiter unten angesiedelt sind, infrage gestellt.
Denn auch wenn es Sex-Unterschiede gibt: So groß sind sie nicht – vielmehr werden sie oft überbewertet. Doch Forschung, die sich differenziert mit den verschiedensten sozialen Faktoren und ihren Auswirkungen auf die individuelle Gesundheit beschäftigt, ist teuer. Notwendig ist sie aber unbedingt: Denn Gender Medizin darf nicht bedeuten, Frauen und Männer in zwei biologische Lager zu spalten und auf dahinter stehende Konstruktionsmechanismen zu vergessen.
Gender Bias
Lange Zeit unterlag die Medizin einem Gender Bias und agierte alles andere als geschlechtergerecht. Margrit Eichler und andere Wissenschaftler_innen definierten drei wesentliche Formen der verzerrten geschlechterbezogenen Wahrnehmung: Androzentrismus, Geschlechterinsensibilität und doppelte Bewertungsmaßstäbe.
Eine androzentristische Perspektive setzt Männer als Norm voraus – Frauen werden unter diesem männlichen Blickwinkel marginalisiert oder sind unterrepräsentiert. Geschlechterinsensibilität heißt, dass das biologische oder soziale Geschlecht außer Acht gelassen wird. Liegen doppelte Bewertungsmaßstäbe vor, werden gleichartige Situationen, Eigenschaften oder Verhaltensweisen je nach Geschlecht unterschiedlich beurteilt. Dazu gehören auch Geschlechterstereotype (Charaktereigenschaften werden als naturgegeben, nicht als sozial konstruiert verstanden) und starre Geschlechterdichotomien: Die Geschlechter werden so behandelt, als wären sie von Grund auf unterschiedliche Gruppen anstatt Gruppen mit sich überschneidenden Merkmalen.
Bettina Enzenhofer
Quelle: Eichler, Margrit, Reisman, Anna Lisa, Borins, Elaine Manace: „Gender Bias in Medical Research“ in Women & Therapy, 12, 4, 1992.
Fußnoten:
(1) ln Veröffentlichungen zu Gender Medizin wird zwar auch auf Transidente oder Intersexuelle Bezug genommen, nichtsdestotrotz wird in der Regel von einem binären Geschlechtersystem ausgegangen.
(2) Nippert, lrmgard: „Frauengesundheitsforschung und ,gender based medicine‘“, in Cottmann, Kortendiek, Schildmann (Hg.innen): Das undisziplinierte Geschlecht. Frauen- und Geschlechterforschung – Einblick und Ausblick. Leske + Budrich 2000.
(3) Voß, Angelika: Frauen sind anders krank als Männer. Plädoyer für eine geschlechtsspezifische Medizin. Heinrich Hugendubel Verlag 2007.
(4) Wimmer-Puchinger, Beate et al.: „Was Frauen gut tut: Frauenpolitische Praxis, Frauengesundheitsforschung, Feministische Theorie“, in: Gerlinde Mauerer (Hg.in): Frauengesundheit in Theorie und Praxis: Feministische Perspektiven in den Gesundheitswissenschaften. Transcript 2010.
(5) Fishman, Jennifer, Wick, Janis, Koenig, Barbara: „The use of ‚sex‘ and ‚gender‘ to define and characterize meaningful differences between men and women“, in: Agenda for Research on Women’s Health for the 21stCentury: A report of the Task Force on the NIH Women’s Health Research Agenda for the 21st Century, 2, 1999.
(6) Krieger, Nancy: „Genders, sexes, and health: what are the connections – and why does it matter?“, in: International Journal of Epidemiology, 32/2003.
(7) Voß, Angelika, Lohff, Brigitte: „Nach-Denkliches zur Gender Medizin“, in: Rieder, Lohff (Hg.innen): Gender Medizin. Geschlechtsspezifische Aspekte für die klinische Praxis. Springer 2004.
(8) Chwosta, Alice: „Frauengesundheit – Gender Medizin quo vadis?“, in: AEP Informationen. Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, 3/2006.
(9) Grace, Victoria: „Beyond dualism in life sciences: implications for a feminist critique of gender-specific medicine“, in: Journal of Interdisciplinary Feminist Thought, 2/1/1/2007.
Weiterführende Literatur:
Hochleitner, Margarethe (Hg.in): Gender Medicine. Ringvorlesung an der Medizinischen Universität Innsbruck. Bände 1-3. Facultas 2008, 2009, 2010.
Legato, Marianne: Evas Rippe. Die Entdeckung der weiblichen Medizin. Kiepenheuer & Witsch 2002.
Dieser Text erschien zuerst in an.schläge November 2010.