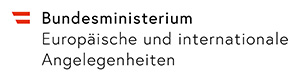Queere Gesundheit: Von Versorgungslücken und Fehlannahmen
Diskriminierungen und Vorurteile haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Warum es nicht egal ist, ob Patient*innen queer sind. Von Bettina Enzenhofer

Das ist die Zusammenfassung von einem Text über die Gesundheit von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, inter und queeren Personen (LGBTIQ). Die Journalistin Bettina Enzenhofer hat den Text geschrieben.
Internationale Studien zeigen schon lange: LGBTIQ-Personen stoßen im Gesundheits-System oft auf Probleme. Zum Beispiel: Das Gesundheits-Personal weiß zu wenig über LGBTIQ-Personen und ihre Gesundheit. Es gibt zu wenig Forschung und das Thema kommt im Medizin-Studium zu wenig vor. Ein weiteres Problem: Es gibt Vorurteile und Diskriminierung gegen LGBTIQ-Personen – auch in Arztpraxen. Am häufigsten erleben trans und inter Personen Diskriminierung von Ärzt*innen. Aus Angst vor Diskriminierung gehen manche LGBTIQ-Personen nicht zu Ärzt*innen, auch wenn sie krank sind.
Internationale Studien zeigen auch: Die körperliche und seelische Gesundheit von LGBTIQ-Personen ist im Vergleich zur Allgemein-Bevölkerung schlechter. Dafür gibt es viele Gründe. Ein Grund ist die rechtliche und gesellschaftliche Diskriminierung von LGBTIQ-Personen. Diskriminierung und Vorurteile bedeuten für LGBTIQ-Personen großen Stress. Das ist schlecht für die Gesundheit.
Seit 2022 gibt es in Österreich einen LGBTIQ-Gesundheitsbericht. Er bestätigt die internationalen Studienergebnisse. Und er hat viele Lösungs-Vorschläge. Zum Beispiel: Schulungen für das Gesundheits-Personal.
Es ist wichtig, dass Ärzt*innen mehr über LGBTIQ-Patient*innen wissen und sie gut behandeln. Gesundheit ist ein Menschen-Recht. LGBTIQ-Personen haben dasselbe Recht auf Gesundheit wie alle anderen Menschen.
Bettina Enzenhofer hat diese Zusammenfassung geschrieben. Hast du Fragen zum Text? Schreib an die Redaktion: be(at)ourbodies.at
Ich hatte es befürchtet und nun bestätigte es auch mein Gynäkologe: Ich hatte mir eine Infektion eingefangen. Noch auf dem Untersuchungsstuhl sitzend fragte ich, ob diese Infektion sexuell übertragbar sei. Aber die Antwort meines Arztes war wenig hilfreich: Er sprach von einem Partner und von Penissen. Meine Lebensrealität kam nicht vor.
Ich oute mich nicht gerne vor Menschen, deren Reaktion ich nicht einschätzen kann. Erst recht nicht, wenn es sich um Ärzt*innen handelt, auf deren Verständnis ich angewiesen bin – und noch weniger gern, wenn ich halbnackt im Gyn-Stuhl sitze. Um mich sexuell verantwortungsvoll verhalten zu können, musste ich aber mehr über meine Infektion in Erfahrung bringen. Also habe ich notgedrungen meinen Gynäkologen auf meine Partnerin hingewiesen und konkreter gefragt: Kann meine Infektion von Vulva zu Vulva übertragen werden? Darauf hatte er keine Antwort.
Wenig Wissen, viele Barrieren
Mit diesem Erlebnis bin ich nicht allein: Beim Zugang zur Gesundheitsversorgung stoßen queere Personen nach wie vor auf Barrieren und Diskriminierungen, wie etliche Studien herausgefunden haben. Zu den Barrieren gehören mangelnde Kenntnisse von Behandler*innen über die spezifischen Gesundheitsbedürfnisse von LGBTI-Personen genauso wie die Angst, sich vor Ärzt*innen hinsichtlich der eigenen sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsmerkmale zu outen – darauf hat beispielsweise 2018 das EU-Projekt „HEALTH4LGBTI“ hingewiesen. Auch Vorurteile und Diskriminierung seitens des Gesundheitspersonals bis hin zur Verweigerung von Behandlungen aufgrund der sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsmerkmale der Patient*innen zählen zu den Barrieren in der gesundheitlichen Versorgung. Insbesondere bisexuelle, trans und inter Personen gaben bei HEALTH4LGBTI an, auf spezifische Barrieren im Gesundheitswesen und mangelndes Wissen seitens der Behandler*innen getroffen zu sein. Schon die Annahme, dass alle Patient*innen heterosexuell, cis und nicht-intergeschlechtlich sind oder dass es egal ist, ob jemand queer ist, ist eine Barriere, so HEALTH4LGBTI.
Frau Müller, bitte!
Meine nächste Gynäkologin fragte bei meinem ersten Termin, wie ich verhüte – eine legitime Frage. Aber für Menschen, die aufgrund ihres Sexuallebens nicht schwanger werden können, bedeutet diese Formulierung: Dein Gegenüber denkt deine Lebensrealität nicht mit. Wenn du zum Beispiel lesbisch bist und ehrlich antwortest, outest du dich gleichzeitig. Und es ist unklar, wie dein Gegenüber auf ein Outing reagieren wird: Eine asexuelle Person läuft mitunter Gefahr, als krank abgestempelt zu werden; auch eine Person, die keine Schwangerschaft verhüten muss, weil in ihrem Sexualleben keine Eizellen auf Samenzellen treffen, wird möglicherweise queerfeindlich diskriminiert. Ein erzwungenes, unerwünschtes Outing erleben nicht-binäre, trans und inter Personen mitunter sogar noch vor dem Behandlungszimmer: Beispielsweise, wenn sie im Wartezimmer mit dem falschen Vornamen oder mit einer falschen Anrede aufgerufen werden.
2024 hat die Europäische Agentur für Grundrechte (FRA) in ihrer bereits dritten europaweit durchgeführten LGBTIQ-Umfrage erneut bestätigt: 14 Prozent der über 100.000 Befragten gaben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten im Gesundheitswesen diskriminiert wurden. Besonders häufig sind diese Erfahrungen unter trans und inter Personen: 40 Prozent der befragten trans Männer, 39 Prozent der trans Frauen und 31 Prozent der inter Personen gaben an, diese Form der Diskriminierung erlebt zu haben; 13 Prozent der trans Frauen wurde eine Behandlung verweigert. Aus Angst vor Diskriminierung haben 18 Prozent der trans Frauen und 17 Prozent der trans Männer auf eine notwendige medizinische Behandlung verzichtet.
Darüber hinaus zeigte die Umfrage, wie verbreitet menschenrechtswidrige Behandlungen nach wie vor sind: In der Gruppe der befragten inter Personen gaben 57 Prozent an, dass vor der hormonellen oder operativen Veränderung ihrer Geschlechtsmerkmale weder sie noch ihre Eltern eine auf Kenntnis der Sachlage basierende Zustimmung gegeben haben. Inter* Personen kämpfen seit Jahrzehnten dafür, diese medizinisch nicht notwendigen, menschenrechtswidrigen Behandlungen zu verbieten.
Keine medizinische Hilfe suchen
Die im Gesundheitssystem erlebte Diskriminierung und Stigmatisierung kann dazu führen, dass queere Personen den Besuch bei Ärzt*innen vermeiden, auch wenn sie Beschwerden haben. Das betrifft nicht nur Gynäkolog*innen, Urolog*innen oder Ärzt*innen für Geschlechtskrankheiten, sondern alle medizinischen Fachrichtungen. Denn queere Gesundheitsfragen betreffen den ganzen Körper, nicht nur die Genitalien.
LGBTIQ-Personen nehmen etwa seltener Untersuchungen zur Krebsvorsorge in Anspruch – auch das hat die FRA-Studie einmal mehr bestätigt. Nur zehn Prozent der Befragten hat in den letzten zwölf Monaten eine Mammografie gemacht, 27 Prozent einen PAP-Abstrich. In der Allgemeinbevölkerung waren es je 36 Prozent.
Diskriminierung macht krank
Weitere Probleme für queere Menschen: Sie kommen im Medizinstudium nur selten vor und es gibt zu wenig Forschung, insbesondere fehlt es an intersektionaler Forschung. Studiendesigns sind meistens binär: Es geht um Krankheiten von cis Männern und cis Frauen. Dabei wäre es wesentlich, spezifische Krankheitsrisiken aller Geschlechter zu erforschen und in der Lehre zu vermitteln. Insbesondere die Risiken von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, psychischen Erkrankungen oder die Folgen von körperlicher oder psychischer Gewalt. Denn der Gesundheitszustand von queeren Personen unterscheidet sich von dem der Mehrheitsbevölkerung. Er ist im Vergleich schlechter – körperlich und psychisch.
Die Diskriminierung im Alltag, queerfeindliche Gesetze, hetero- und cis-normative Geschlechtervorstellungen der Dominanzgesellschaft, Vorurteile, Mobbing oder Übergriffe bedeuten massiven Stress, dessen Folgen sich körperlich und psychisch zeigen können. Die Studie HEALTH4LGBTI sieht bei LGBTI-Personen signifikante physische und psychische Ungleichheiten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, beispielsweise kamen Suizidgedanken, Suchterkrankungen, Angsterkrankungen oder selbstverletzendes Verhalten bei den Befragten häufiger vor als in der Allgemeinbevölkerung. Auch die FRA-Studie zeigte im Bereich psychischer Gesundheit die Folgen von Gewalt und Diskriminierung queerer Menschen: So hatten 37 Prozent aller Befragten in den letzten zwölf Monaten Suizidgedanken. Noch höher waren die Anteile bei trans Frauen (59 Prozent), trans Männern (60 Prozent) sowie bei nicht-binären (55 Prozent) und pansexuellen Befragten (59 Prozent). Wo Diskriminierungserfahrungen eine Belastung für die Gesundheit sind, sind es erst recht die Folgen von Mehrfachdiskriminierung, beispielsweise Verschränkungen von Rassismus, Armut, Klassismus, Ableismus oder Sexismus und Queerfeindlichkeit, wie die FRA-Studie belegt: So zeigten sich Suizidgedanken häufiger bei LGBTIQ-Personen mit Behinderungen, bei LGBTIQ-Personen, die einer weiteren Minderheit angehören, bei jungen LGBTIQ-Personen sowie bei denen, die arbeitslos oder sozioökonomisch benachteiligt sind.
Endlich: Zahlen aus Österreich
In Österreich gab es lange Zeit keine Daten zum Gesundheitszustand der queeren Bevölkerung, erst 2022 wurde hierzulande der erste LGBTIQ+ Gesundheitsbericht veröffentlicht. Er zeigt ähnliches wie internationale Studien, beispielsweise weit verbreitete psychische Probleme der LGBTIQ+-Bevölkerung. So hatten von den befragten 1.047 Personen in den letzten zwölf Monaten 53 Prozent eine Depression, 39 Prozent eine Angststörung, 34 Prozent ein Burn-out, 20 Prozent eine Posttraumatische Belastungsstörung, 19 Prozent eine Essstörung, 12 Prozent eine Zwangsstörung und 15 Prozent eine andere psychische Erkrankung. 25 Prozent der befragten trans Personen, 21 Prozent der nicht-binären Personen und acht Prozent der inter Personen haben bereits einen Suizidversuch gemacht; außerdem zwölf Prozent der lesbischen Befragten, acht Prozent der schwulen, 17 Prozent der bi-/pansexuellen und 19 Prozent der queeren Befragten bzw. der Befragten mit weiteren sexuellen Orientierungen.
Auch zum Thema Diskriminierung im Gesundheitsbereich belegt der Bericht die Aussagen aus internationalen Studien. Insgesamt haben sich 54 Prozent der Befragten in den letzten zwei Jahren im Gesundheitsbereich diskriminiert gefühlt. Mit rund drei Viertel werden trans, inter, und nicht-binäre Menschen besonders häufig diskriminiert – im Vergleich zu 45 Prozent der cis Personen. Die Studienteilnehmer*innen gaben beispielsweise an, unangebrachte Kommentare vom medizinischen Personal zu bekommen (61 Prozent der Befragten), sich unter Druck gesetzt zu fühlen, einer bestimmten medizinischen oder psychologischen Maßnahme zuzustimmen (42 Prozent), vom medizinischen Personal erniedrigt, gedemütigt oder beleidigt zu werden (29 Prozent) oder überhaupt abgewiesen bzw. nicht behandelt zu werden (27 Prozent). Bei 33 Prozent der Befragten wurden Diagnosen bzw. Behandlungen ohne Grund mit ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer Variation der Geschlechtsmerkmale in Verbindung gebracht – zum Beispiel wurde eine Migräne mit der Geschlechtsidentität in einen Zusammenhang gebracht. Und während 65 Prozent aller Befragten angeben, dass ihre sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder Variation der Geschlechtsmerkmale von Gesundheitsdienstleister*innen nicht pathologisiert wurden, sagt das in der Gruppe der inter Befragten nur 25 Prozent. Mit dem richtigen Namen und Pronomen angesprochen wurden fast alle cis Befragten, wenig bis gar nicht zutreffend ist diese Aussage für 48 Prozent der nicht-binären, 42 Prozent der inter und 31 Prozent der trans Befragten. Nur 24 Prozent aller Befragten stimmen der Aussage „sehr“ oder „ziemlich“ zu, dass deren Ärzt*innen zu LGBTIQ*-spezifischen Gesundheitsthemen informiert sind. 49 Prozent gaben an, trotz gesundheitlichen Bedarfs keine Gesundheitseinrichtungen in Anspruch genommen zu haben, aus Angst, dort nicht gut behandelt zu werden.
So wie die internationalen Forschungsergebnisse zeigt auch der österreichische Bericht klar: Ärzt*innen bzw. Mitarbeiter*innen von Gesundheitsberufen sind nicht ausreichend sensibilisiert im Umgang mit queeren Patient*innen, es fehlt ihnen an Wissen über queere Gesundheitsthemen. Der Bericht endet mit mehr als 250 Maßnahmen, die die Gesundheit von LGBTI+-Menschen in Österreich verbessern können.
Wie kommen wir da raus?
Als ich vor einigen Jahren bei einer Podiumsdiskussion zu queerer Gesundheit auf Barrieren und Ungleichheiten hingewiesen habe, kam aus dem Publikum Kritik: Ich soll queere Menschen nicht als Opfer darstellen. Doch es geht nicht um Opfer-Zuschreibungen. Nimmt man das Menschenrecht auf Gesundheit von queeren Personen ernst, so geht es darum, die strukturell schlechtere gesundheitliche Versorgung queerer Menschen wahrzunehmen und zu benennen. Und im nächsten Schritt geht es darum, etwas gegen diese Versorgungslücken zu tun.
Um diesem Ziel näherzukommen, muss man auf vielen Ebenen ansetzen – eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik gehört genauso dazu wie Antidiskriminierungspolitik auf allen Ebenen oder die Prävention von Suiziden, Gewalt oder Bullying in unterschiedlichen Settings. Eine konkretere und stets genannte Maßnahme richtet sich speziell an medizinisches Personal: Es braucht Training und Reflexion von allen, die in Gesundheitsberufen arbeiten. Initiativen wie queermed in Österreich oder Queermed Deutschland beschreiben beispielsweise in Leitfäden für Ärzt*innen bzw. Mitarbeiter*innen im Gesundheitswesen, wie diese sensibel mit queeren Patient*innen umgehen können. Speziell zu trans, inter und nicht-binären Patient*innen hat der Verein Nicht Binär eine Broschüre veröffentlicht, ebenso TransInterQueer und der Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich. Auch das Projekt HEALTH4LGBTI hat Trainingsmaterialien für Gesundheitsberufe entwickelt. In Österreich hat kürzlich das Gesundheitsministerium ein kostenloses E-Learning-Tool zu LGBTIQ+ veröffentlicht, das sich an alle richtet, die in Gesundheitsberufen arbeiten, ebenso die Broschüre „Vielfalt willkommen heißen“ mit Tipps für einen queersensiblen Umgang mit Patient*innen.
Die körperliche Integrität aller Menschen muss sichergestellt sein, insbesondere im Gesundheitssystem – eine entpathologisierende Herangehensweise ist dringend notwendig. Es braucht es ein explizites Bekenntnis zur Antidiskriminierung in den Versorgungsstrukturen. Und es braucht Gesundheitsstrukturen, die wirklich für alle Menschen zugänglich sind.
Darüber hinaus müssen LGBTIQ-Inhalte in den medizinischen Curricula und in Weiterbildungen selbstverständlich vorkommen – genauso wie Inhalte über nicht-queere Personen auch. Die Annahme, dass Patient*innen nicht queer sind, dass das Thema für das Gesundheitspersonal nicht relevant sei oder dass es keine Diskriminierung queerer Menschen geben würde, muss vom Gesundheitspersonal hinterfragt werden, heißt es in der Studie HEALTH4LGBTI. Ebenso ist mehr Forschung zur Gesundheit von queeren Personen notwendig, beispielsweise zu spezifischen Themen wie der Menopause oder der Gesundheit von queeren Personen im Alter. Dabei gilt es, in der Gruppe der queeren Personen die Menschen in den Fokus zu rücken, die mehrfach diskriminiert werden.
Solange die Diskriminierung queerer Personen im Gesundheitswesen noch gegenwärtig ist, können queere Patient*innen immerhin auf die Arbeit von Aktivist*innen zurückgreifen und bei queermed und Queermed Deutschland nach queerfreundlichem Gesundheitspersonal suchen.
Ich habe einmal zu einer Ärztin gesagt, dass LGBTIQ-Inhalte im Medizinstudium kaum vorkommen – oder wenn, dann nur an Stellen, in denen es um sexuell übertragbare Infektionen geht. Sie wüsste nicht, warum das ein Problem sei, so ihre Antwort – und außerdem würde sie alle Menschen gleich behandeln. Doch wenn alle Menschen unreflektiert „gleich“ behandelt werden, heißt das auch, dass es an Sensibilität und Wissen über spezifische Lebenslagen, gesundheitsbezogene Bedürfnisse und spezifische Krankheitsrisiken fehlt. Wenn alle gleich behandelt werden, fehlt es an Wissen darüber, welche Barrieren es für queere Personen in der Gesundheitsversorgung gibt, es fehlt an Wissen über die Auswirkungen von Mikroaggressionen, erhöhtem Stress durch Alltagsdiskriminierung und darüber, wie man für queere Menschen gleiche Chancen in der Gesundheitsversorgung bieten kann. Es fehlt an Wissen über Medizingeschichte und über die viel zu lang andauernde Pathologisierung queerer Menschen. Gesundheit ist ein Menschenrecht – für queere Menschen genauso wie für alle anderen.
Dieser Artikel wurde gefördert durch: