Unseriöse Verallgemeinerungen
Die Datenlage zu Geschlechterunterschieden im Gehirn ist weit komplexer, als uns viele Autor_innen weismachen wollen. Bettina Enzenhofer erklärt, warum Misstrauen angebracht ist.
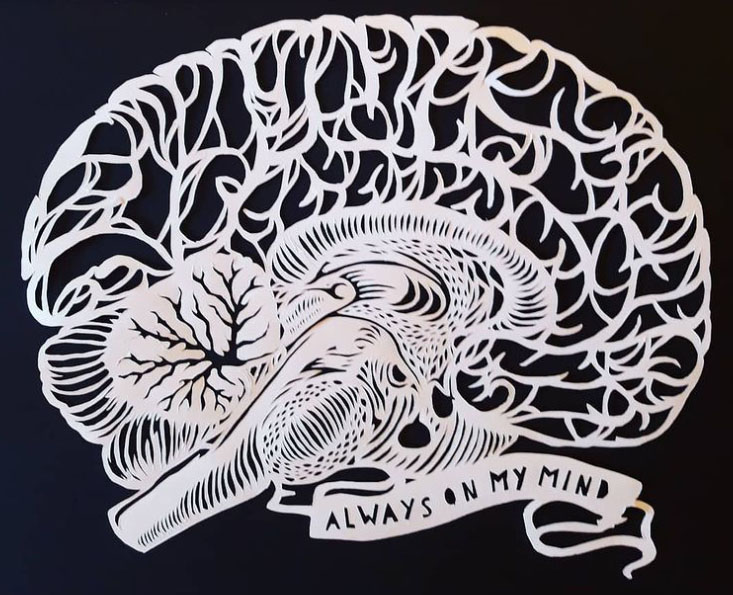
„Frauen und Männer sind unterschiedlich. Nicht besser oder schlechter, sondern unterschiedlich. Außer der Tatsache, dass sie der gleichen Spezies angehören, gibt es keine nennenswerten Gemeinsamkeiten zwischen ihnen.“ So beginnt das Buch „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“. Geschrieben haben es die Kommunikationstrainer_innen Barbara und Allan Pease. Und schon der Untertitel verrät, was uns das Paar sagen will: „Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche Schwächen“. Denn Pease & Pease geben erstens vor, naturwissenschaftliche Erkenntnisse aufzuarbeiten, die, zweitens, für die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Frauen und Männern verantwortlich sein sollen. Dabei argumentieren sie auf einfachste Weise und brechen komplexe Zusammenhänge unseriös herunter. Man liest dann bspw., dass „die Funktionsweise des weiblichen Gehirns bedeutende Unterschiede zu der des männlichen aufweist“ und hier „die Quelle (fast) allen Übels in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen“ liege. Dieser direkte und eindeutige Zusammenhang, der angeblich zwischen Gehirn und Verhalten besteht, findet sich bei Pease & Pease immer wieder: Die meisten Männer würden demnach in einem bestimmten Hirnareal Richtungen „spüren“ können, weswegen sie sich auch besser orientieren könnten. Frauen hingegen hätten ausgezeichnete Sprachfähigkeiten, weswegen es sie auch zu lehrenden Berufen ziehe. Doch mit einem solchen biologischen Determinismus machen es sich Pease & Pease viel zu einfach.
Gehirne in Blau und Rosa
Allerdings sind sie nicht die Einzigen, die mit solcherart reproduzierten Binaritäten Kapital schlagen: Die Neurobiologin Louann Brizendine wurde etwa mit ihrem Buch „Das weibliche Gehirn: Warum Frauen anders sind als Männer“ berühmt. Der Psychologe Simon Baron-Cohen teilte in „Frauen denken anders, Männer auch. Wie das Geschlecht ins Gehirn kommt“ das Gehirn in einen Empathie- und einen Systematisierungs-Typ. Ersterer sei bei mehr Frauen vertreten, Zweiterer bei mehr Männern. Auch Medien überraschen nicht mehr, wenn sie die „spektakulären Unterschiede zwischen weiblichem und männlichem Gehirn“ aufs Cover heben, wie etwa das österreichische Nachrichtenmagazin „profil“ im Juli 2011. Um die Unterschiede zu verdeutlichen, wurde auf dem „profil“-Cover ein Gehirn in eine blaue und eine rosa Hälfte eingefärbt, untertitelt mit den Worten „Eine Frau ist kein Mann“. Was wissen aber Hirnforscher_innen wirklich über die Substanz in unseren Köpfen? Wie spektakulär sind die Geschlechterunterschiede im Hirn-Vergleich? Und warum liegt der Blick eigentlich auf den Unterschieden und nicht auf den Gemeinsamkeiten?
Neu ist die Fokussierung auf Geschlechterunterschiede im Gehirn jedenfalls nicht. Schon 1861 behauptete der französische Arzt und Anthropologe Paul Broca, dass das weibliche Gehirn kleiner sei als das männliche, was mit einem Unterschied in der Intelligenz korrelieren würde – zugunsten der Männer. Damals mussten sich Forscher noch damit begnügen, das Gehirn nach dem Tod zu vermessen. Bestimmt wurde neben der Größe bspw. auch das Gewicht des Gehirns – immer auch im Geschlechtervergleich. Mittlerweile kann man mit verschiedenen technischen Geräten ins lebende Gehirn sehen, und je nach Fragestellung z.B. Schnittbilder eines Gehirns im Ruhe- oder aktiven Zustand berechnen. Populär sind heute Untersuchungen, bei denen Proband_innen in einem Magnetresonanztomografen liegen und verschiedene Aufgaben lösen sollen. Die Frage nach den Unterschieden zwischen den Geschlechtern ist dabei auch heute noch zentral.
Verzerrungen
Anders als uns populärwissenschaftliche oder mediale Stimmen immer noch glauben machen wollen, stellen sich aktuelle Befunde der Neurowissenschaften jedoch keineswegs eindeutig dar. Eine besondere Verantwortung kommt daher allen zu, die ein bestimmtes Wissen über das Gehirn kommunizieren: Den Wissenschaftler_innen sowie den Herausgeber_innen von Journalen, in denen Hirn-Studien publiziert werden, sowie den Geldgeber_innen, die bestimmte Studien finanzieren wollen. Den Hirnforscher_innen, die populärwissenschaftlich schreiben und mitunter unseriös zitieren. Und nicht zuletzt den Journalist_innen, die Studienergebnisse oft auf unlautere Weise verkürzt wiedergeben. „Publication bias“ nennt man in diesem Zusammenhang folgendes Phänomen: Es existieren Studien, die einen Geschlechterunterschied zum Ergebnis haben, und solche, die keinen finden. Allerdings sind die Ergebnisse, die keinen Unterschied feststellen, viel schwieriger zu publizieren als erstere – und sie werden auch von der Scientific Community seltener zitiert. Es kommt somit schon lange bevor Pease & Pease und Co. ihr „Wissen“ verbreiten zu einer verzerrten Darstellung der Datenlage. Unlängst mahnte deshalb die Neurobiologin Lise Eliot zur Vorsicht: Die Komplexität der geschlechtlichen Hirndifferenzierung – d.h. auch die wirkliche Größe und verschiedenen Ursachen von Geschlechterunterschieden in Hirn und Verhalten – müsse auch so kommuniziert werden. Und: Hirnforscher_innen sollten Frauen und Männer untersuchen und ihre Ergebnisse präsentieren – auch wenn das Ergebnis ist, dass es keinen Unterschied gibt. Das passiere, so Eliot, jedoch oft nicht, denn Wissenschaftler_innen und Herausgeber_innen sind an derartigen „negativen“ Ergebnissen nicht interessiert.
Unhinterfragte Vorannahmen
Hirnforscher_innen untersuchen heute bestimmte Gruppen von Menschen, z.B. Frauen/Männer oder Mörder/Nicht-Mörder, und fragen, inwiefern sich deren Hirn-Strukturen und -Funktionen unterscheiden, wie sehr diese Unterschiede von vornherein festgelegt sind und ob diese Unterschiede das Verhalten determinieren. Um solche Studien durchführen zu können, muss man jedoch von einigen Vorannahmen ausgehen, wie schon die Biologin Sigrid Schmitz betonte: Zuerst muss eine binäre Gruppierung mit einer eindeutigen Trennlinie bestimmt werden. Diese beiden Gruppen müssen eindeutige Verhaltensunterschiede aufweisen. Auch die biologische Materie des Gehirns muss klar abgrenzbare Differenzen aufweisen – eine weitere Vorannahme. Diese Unterschiede müssen außerdem messbar sein. Nicht zuletzt geht man von der Prämisse aus, dass Unterschiede im Gehirn und Verhalten direkt zusammenhängen, so Schmitz. Und auch wenn man sich über all diese Vorannahmen bewusst ist und sie möglicherweise sogar transparent macht (etwa, wie das Geschlecht der Proband_innen bestimmt wurde), bleibt noch ein Problem: Selbst wenn ein Unterschied zwischen den Geschlechtern gefunden werden kann, weiß man nicht, warum dieser Unterschied existiert. Denn eine bestimmte Datengrundlage kann bspw. biologisch-deterministisch interpretiert werden, etwa in der Form, dass bestimmte Unterschiede angeboren oder durch Hormone entstanden wären. Eine andere Erklärung könnte sein, dass Erfahrung und Umwelt das Gehirn beeinflusst hätten – der sogenannte bio-psycho-soziale Ansatz. Einen wesentlichen Schritt weiter geht das Plastizitätskonzept: Hier gibt es kein biologisches Substrat mehr, das nur beeinflusst wird, sondern Vertreter_innen der Hirnplastizität gehen von einer ständigen Wechselwirkung zwischen Biologie und Kultur aus, die so stark ist, dass es keinen rein biologischen „Rest“ mehr gibt.
Die Sozialmedizinerin Rebecca Jordan-Young konnte anhand einer Analyse von Studien, in denen die Gehirne von homo- und heterosexuellen Menschen verglichen wurden, verdeutlichen, wo der Haken dieser Vorannahmen und Gruppierungen liegt: Es stellt sich nämlich die Frage, wie Homo- oder Heterosexualität definiert werden. Geht es darum, wer mit wem Sex hat? Oder um Begehren? Um Selbst- oder Fremdzuschreibungen? Ist man noch homosexuell, wenn man auch heterosexuelle Fantasien hat? Jordan-Young fand heraus, dass in wissenschaftlichen Untersuchungen diese Definition – sofern es überhaupt eine gibt – je nach Studie unterschiedlich ausfällt. Im Extremfall bedeutet das, dass ein bestimmtes Konzept von Heterosexualität in einer anderen Studie als Homosexualität gefasst wurde. Das macht eine Vergleichbarkeit dieser Studien schwierig.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Im Geschlechtervergleich gehen Hirnforscher_innen derzeit davon aus, dass es manche Unterschiede in Hirnstruktur und -funktion gibt. Allerdings sind diese oft nur sehr klein und überdies immer als statistischer Durchschnitt zu sehen: Die Variabilität innerhalb einer Geschlechtergruppe ist relativ hoch, die Gemeinsamkeiten sind größer als die Unterschiede. Weder sagt das biologische Geschlecht eines Individuums etwas über dessen konkretes Gehirn aus, noch lassen sich von einem individuellen Gehirn Rückschlüsse auf das Geschlecht ziehen.
Die komplexe Datenlage zeigt sich auch auf der Ebene der Hirnstrukturen: Das Gehirn von Männern ist zwar durchschnittlich um zehn bis 15 Prozent größer und schwerer als das von Frauen. Allerdings bedeutet das nicht, dass damit auch bessere kognitive Leistungen einhergehen. Das Vorhandensein von Geschlechtsunterschieden in konkreten, regionalen Hirnstrukturen, etwa dem Hippokampus, ist umstritten. Auch der seit den 1970er Jahren beforschte Corpus Callosum konnte die Suche nach Differenzen nicht befriedigen: Dieses Areal liegt zwischen den beiden Hirnhälften. Werden diese stärker beansprucht – das wird gemeinhin Frauen zugesprochen –, so müsste das Informationen austauschende Faserbündel des Corpus Callosum stärker ausgeprägt und infolgedessen das Corpus Callosum größer als bei Männern sein – das ist die Annahme, die diesem Untersuchungsareal zugrunde liegt. Jedoch: Abgesehen vom fundamentalen Problem der Vermessung des Corpus Callosum ist die Datenlage widersprüchlich, und die Variabilität innerhalb einer Geschlechtergruppe scheint weit größer zu sein als die Unterschiede zwischen den Gruppen. Außerdem ist die Größe des Corpus Callosum nicht nur biologisch determiniert, sondern wird von vielen Faktoren, z.B. dem Alter oder dem Umstand, ob jemand Rechts- oder Linkshänder_in ist, beeinflusst.
In einem aktuellen Artikel stellt die Psychologin Daphna Joel die Einteilung in ein „männliches“ und „weibliches“ Gehirn überhaupt völlig infrage: Weil das Gehirn hochgradig variabel ist und ein bestimmter Mensch in manchen Hirncharakteristiken „männlich“, in anderen „weiblich“ sein kann, ist die Hirnforschung möglicherweise besser beraten, nicht von einem geschlechtlichen Dimorphismus (das würde bedeuten, dass es keine bzw. nur eine minimale Überlappung zwischen zwei Ausprägungen gibt, was auf nur sehr wenige Hirncharakteristiken zutrifft), sondern von einem „intersexuellen“ Gehirn auszugehen.
„Die Sprache“ und „die Frauen“
Auch für die Ebene der Hirnfunktion gilt: Sieht man sich Studien und deren spätere Referenzierung im Detail an, so bemerkt man oft schon innerhalb einer Studie methodische Mängel und unzulässige Generalisierungen. Dies lässt sich hervorragend anhand der berühmten Studie von Bennett und Sally Shaywitz et al. verdeutlichen. 1995 untersuchten sie, inwieweit Sprache im Hirn geschlechtsspezifisch unterschiedlich verarbeitet wird. 19 Frauen und 19 Männer mussten verschiedene Aufgaben lösen, die mit Sprache zu tun hatten. Leistungsunterschiede zeigten sich nicht. Shaywitz et al. stellten aber eine teilweise unterschiedliche Aktivierung in einem bestimmten Gehirnareal fest, und hier liegt der kritische Punkt: Dieser Unterschied wurde nur für eine der kognitiven Aufgaben gemessen, nämlich bei der Reim-Erkennung, und auch nicht bei allen Frauen, sondern nur bei elf der 19. Diese elf Frauen zeigten tatsächlich Aktivierungsmuster in beiden Hirnhälften, d.h. bilateral, wohingegen bei den 19 Männern die Aktivierung mehr in der linken Hemisphäre gemessen wurde. Im Abstract der Studie heißt es dann verallgemeinernd, es gäbe in der funktionellen Hirnorganisation einen klaren Beweis für einen Geschlechtsunterschied auf der Ebene der Reimerkennung. Der Titel der Studie liefert eine weitere Generalisierung: „Sex differences in the functional organization of the brain for language“ – aus der Reim-Erkennung wurde nun „die Sprache“, aus einer kleinen Proband_innengruppe „die Geschlechterunterschiede“. Das bleibt dann auch übrig, wenn die Studie unseriös zitiert wird, wie das etwa Pease & Pease machen: Shaywitz et al. hätten bestätigt, dass „bei Männern vor allem die linke Gehirnhälfte für die Sprache zuständig ist, während bei Frauen dafür beide Gehirnhälften eingesetzt werden“. Pease & Pease behaupten an einer anderen Stelle sogar, dass Männer im Gegensatz zu Frauen „keine eigene Gehirnregion, die als Sprachzentrum fungieren würde“, hätten – auch das ist nicht korrekt. In einer anderen Studie mit fünfzig Frauen und fünfzig Männern ließen sich die Befunde von Shaywitz et al. übrigens nicht bestätigen: Julie Frost et al. konnten keine Lateralitätsunterschiede (d.h. ob nur eine oder beide Hirnhälften benutzt werden) in der Aktivierung finden. Auch durch weitere Forscher_innen und Meta-Analysen konnte die sogenannte Lateralitätshypothese hinsichtlich der Sprachverarbeitung nicht bestätigt werden. Und obwohl es Studien gibt, bei denen in manchen sprachlichen Leistungen Unterschiede zugunsten der Frauen gefunden wurden (bspw. wenn zuvor gelernte Wortlisten frei wiedergegeben werden müssen), bleibt unklar, inwieweit sich dieser Leistungsunterschied im Gehirn abbildet und ob Biologie, Kultur oder deren Interaktion dafür verantwortlich sind.
Frauen können einparken
Ebenso komplex stellen sich auch die Studienergebnisse zu einem weiteren beliebten Forschungsfeld, der „räumlichen Orientierung“, dar. Hinsichtlich der Verhaltensleistungen zeigen sich nur in einer speziellen Aufgabe signifikante Geschlechterunterschiede, nämlich in der sogenannten „mentalen Rotation“. Hier geht es darum, dreidimensionale Figuren um eine oder mehrere räumliche Achsen mental zu rotieren und so zu überprüfen, ob diese Figuren mit einer Ausgangsfigur kongruent sind. Das können im Durchschnitt zwar Männer besser, allerdings gibt es auch einen großen Überschneidungsbereich zwischen den Geschlechtern sowie Faktoren, die den Geschlechterunterschied verringern: So wirken sich etwa zuvor aktivierte Geschlechterstereotype – z.B. das Klischee, dass Frauen generell schlechter in Mathematik sind – negativ für die Bewältigung dieser Aufgabe aus.
Bildgebende Untersuchungen zeigen, dass Männer und Frauen bei mentalen Rotationsaufgaben durchwegs gleiche Areale benutzen. Es gibt zwar einzelne regionale Unterschiede, diese werden aber mit unterschiedlichen Lösungsstrategien erklärt: Frauen wenden eher Strategien an, die für diesen Test nicht so gut geeignet sind. Das könnte wiederum mit einer unterschiedlichen Sozialisation zu tun haben. Ein weiterer Aspekt im Feld „räumliche Orientierung“ betrifft das Navigieren: Frauen werden hier mit „Landmarken“, Männer mit „Richtungsmerkmalen“ assoziiert – das heißt, eine Frau orientiere sich eher an Gebäuden, ein Mann an Himmelsrichtungen oder Distanzen. Studien, die diese Verhaltensunterschiede im Gehirn untersuchten, sind jedoch widersprüchlich. Pease & Pease sprechen übrigens Frauen einen eigenen Bereich für das räumliche Vorstellungsvermögen komplett ab, schlussfolgern daraus, dass sie „über eher bescheidene räumlich-visuelle Fähigkeiten verfügen“ und deshalb auch nur selten Berufe wählen, die solche Fähigkeiten erfordern.
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse besagen anderes. Und spätestens die im „profil“-Artikel zitierte Aussage einer Genderforscherin, dass die Frage nach den Geschlechterunterschieden im Gehirn „hinter alle wissenschaftlichen Diskussionen“ zurückfalle, hätte sogar bei den verantwortlichen Journalistinnen Misstrauen gegenüber ihren eigenen Thesen wecken müssen.
Zum Weiterlesen:
Lise Eliot: The Trouble with Sex Differences. In: Neuron 72, 2011
Anne Fausto-Sterling: Sexing the Body. Gender Politcs and the Construction of Sexuality. Basic Books 2000
Daphna Joel: Male or female? Brains are intersex. In: Frontiers in Integrative Neuroscience 5, 2011
Rebecca M. Jordan-Young: Brain Storm. The Flaws in the Science of Sex Differences. Harvard University Press 2011
Anelis Kaiser: Sex/gender and neuroscience: focusing on current research. In: Martha Blomqvist, Ester Ehnsmyr: Never mind the gap! Gendering Science in Transgressive Encounters. University Printers 2010
Claudia Quaiser-Pohl, Kirsten Jordan: Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken – und Männer ihnen Recht geben. Über Schwächen, die gar keine sind. Deutscher Taschenbuch Verlag 2007
Sigrid Schmitz: Frauen- und Männergehirne. Mythos oder Wirklichkeit? In: Smilla Ebeling, Sigrid Schmitz (Hrsg.): Geschlechterforschung und Naturwissenschaften. Einführung in ein komplexes Wechselspiel. VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006
Dieser Text erschien zuerst in an.schläge II/2012.